GÜTERSLOH. Studierende brauchen für die Anforderungen der Arbeitswelt neue Kompetenzen. Inwieweit diese sogenannten Future Skills in der Lehre bereits gefördert werden, beleuchtet das CHE anhand einer Befragung von rund 6.400 Professorinnen und Professoren für 19 Fächer an deutschen Hochschulen. Dabei wird deutlich: Während einzelne Zukunftskompetenzen bereits in allen untersuchten Fächern etabliert sind, zeigen sich für den Großteil der untersuchten Kompetenzen noch deutliche Fächerunterschiede. Dabei beurteilt die Mehrzahl der Hochschullehrkräfte Future Skills als wichtig für die spätere Berufstätigkeit.
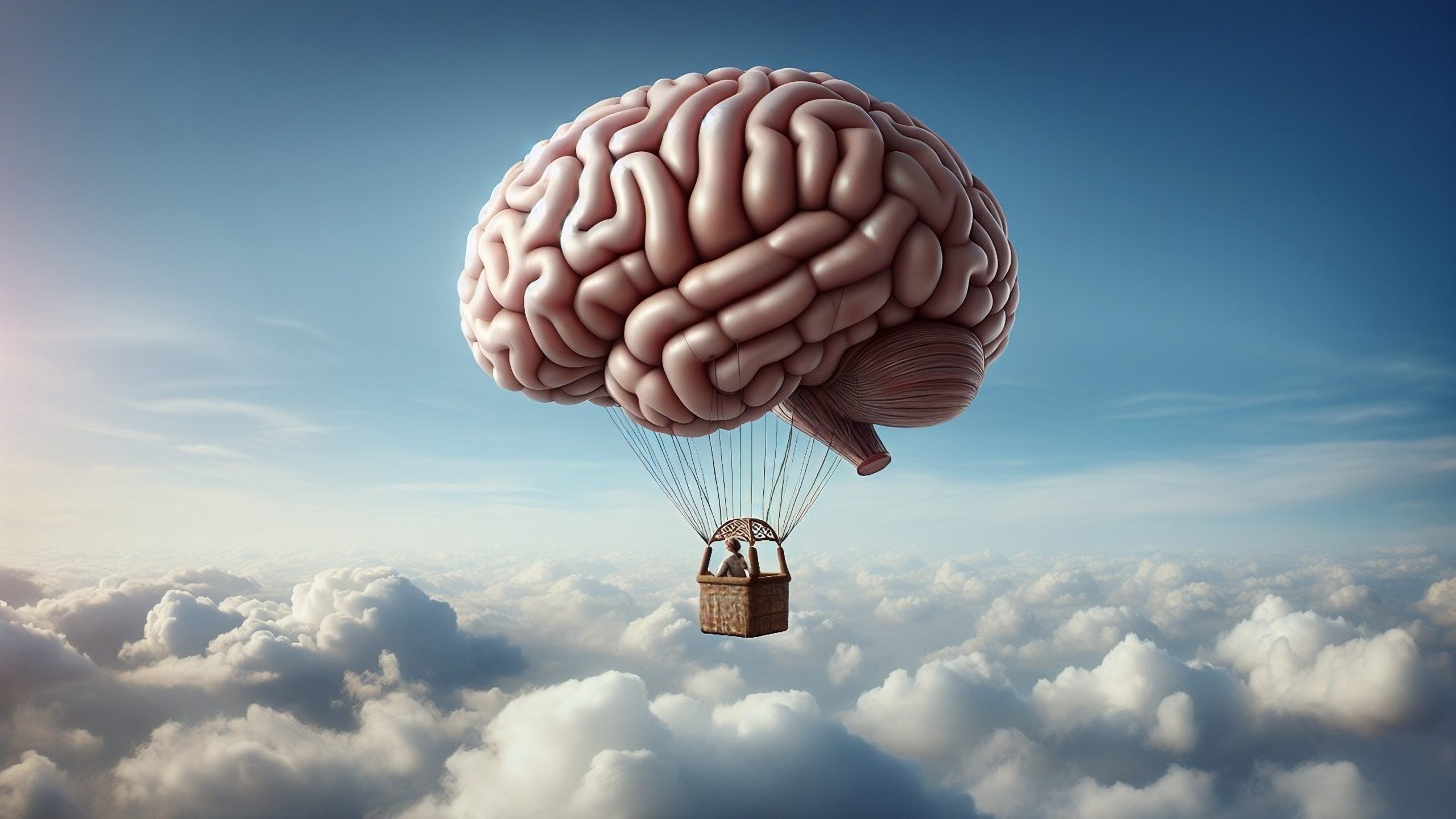
Megatrends wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, aber auch globale gesellschaftliche Herausforderungen, haben weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Zur Bewältigung dieser Aufgaben werden sogenannte Future Skills immer wichtiger. Diese umfassen etwa Kompetenzen zur Selbstorganisation, Innovation – oder auch Resilienz.
„Für die Arbeitswelt von heute und morgen reicht alleinige Fachkompetenz nicht mehr aus“, bilanziert Studienautorin Nina Horstmann. „Absolventinnen und Absolventen müssen später im Berufsleben heute noch unbekannte, komplexe Probleme in heterogenen Teams lösen und neue technologische Entwicklungen in ihren Berufsalltag integrieren können. Diese Kompetenzen sollten im Studium erlernt oder weiterentwickelt werden“, so die Expertin für Future Skills beim CHE Centrum für Hochschulentwicklung.
Für einen Großteil der untersuchten Future Skills ist die Förderung derzeit noch stark fachabhängig
Zu den wichtigsten Future Skills für die spätere Berufstätigkeit gehören nach Ansicht der deutschen Hochschulprofessorinnen und -professoren aktuell: Problemlösekompetenz, kritisches Denken und Kollaboration. Die drei genannten Kompetenzen tauchten in allen untersuchten Fächern jeweils in den Top-5 pro Fach auf. Insgesamt zeigt sich aber auch für den Großteil der weiteren untersuchten Future Skills, dass die überwiegende Mehrzahl der Hochschullehrkräfte diese als wichtig einschätzt. Im Vergleich zu den nicht-digitalen Kompetenzen werden die meisten Digitalkompetenzen allerdings bislang von einem geringeren Anteil an Professorinnen und Professoren als wichtig bewertet.
Neben der Relevanz beurteilten die Dozentinnen und Dozenten auch den Umsetzungsstand bei der bisherigen Vermittlung der Kompetenzen in ihrem Fach. Dabei zeigt sich, dass für einen Großteil der untersuchten Future Skills die Förderung derzeit noch stark fachabhängig ist. So ist nach Einschätzung der teilnehmenden Professorinnen und Professoren das Ausmaß der Förderung für Kollaboration, Kreativität, Entscheidungskompetenz, Kommunikation, Interkulturelle Kommunikation, Dialog- und Konfliktkompetenz, Innovationskompetenz, Veränderungskompetenz, Ambiguitätskompetenz/Umgang mit Unsicherheit, Resilienz und Missionsorientierung sowie für die Digitalkompetenzen noch sehr fachabhängig.
Beispielsweise wird Kollaboration aus Professorensicht besonders häufig im Fach Pflegewissenschaft (89 Prozent) „stark“ bis „sehr stark“ gefördert. Der geringste Anteil an Professorinnen und Professoren, die Kollaboration nach eigenem Bekunden besonders fördern, zeigt sich hingegen im Fach Rechtswissenschaft (18 Prozent). Für letzteres Fach findet sich wiederum der zweithöchste Anteil (89 Prozent; nach Wirtschaftsrecht mit 92 Prozent) an Professorinnen und Professoren, die Entscheidungskompetenz in besonderem Maße fördern.
Digitalkompetenzen werden im Vergleich zu einigen nicht-digitalen Future Skills insgesamt noch deutlich seltener gefördert
„Interessanterweise ist der Anteil der Professor*innen, welche die Wichtigkeit einer Kompetenz hoch einschätzen, bei fast allen Future Skills und Fächern höher als der Anteil der Befragten, die angeben, diese Kompetenz bereits besonders zu fördern“, so heißt es in der Studie.
Und weiter: „So wird etwa im Fach Pflegewissenschaft die interkulturelle Kommunikation von 95 Prozent der Befragten als wichtig eingeschätzt, während lediglich 56 Prozent der Professor*innen dieses Future Skills bereits in besonderem Maße fördern. Im Fach Medizin beurteilen 84 Prozent der Befragten Resilienz als wichtig, jedoch nehmen nur 43 Prozent der Professor*innen diese Kompetenz besonders in den Blick. Im Fach Politikwissenschaft halten 90 Prozent der Befragten Entscheidungskompetenz für wichtig, während nur 64 Prozent der Professor*innen angeben, Entscheidungskompetenz aktuell besonders zu fördern. Für die insgesamt noch wenig geförderte Digitale Ethik zeigt sich etwa im Fach Geographie, dass immerhin 54 Prozent der Professor*innen eine hohe Wichtigkeit angeben, während erst 20 Prozent der Befragten diese Kompetenz in besonderem Maße fördern.“
Digitalkompetenzen werden im Vergleich zu einigen nicht-digitalen Future Skills insgesamt noch deutlich seltener gefördert, doch auch hier zeigen sich bedeutsame Fächerunterschiede. So findet sich – naheliegend – für das Fach Informatik über alle fünf untersuchen Digitalkompetenzen (Digital Literacy, Digitale Kollaboration, Digitales Lernen, Digitale Ethik und Agiles Arbeiten) der höchste Anteil an Professorinnen und Professoren, die diese Kompetenzen besonders fördern. Auch in den Fächern Wirtschaftsinformatik oder Pflegewissenschaft werden Digitalkompetenzen schon von einem bedeutsamen Anteil der Dozentinnen und Dozenten gefördert. Im Fach Rechtswissenschaft ist hingegen der Anteil der Professorinnen und Professoren, die Digitalkompetenzen in besonderem Maße in ihre Lehre einbeziehen, gering.
Hier sieht Studienleiterin Nina Horstmann den größten Aufholbedarf: „Inwieweit Künstliche Intelligenz unsere Lebens- und Arbeitswelt in den kommenden Jahren verändern wird, können wir bisher nur erahnen. Umso wichtiger ist es, die Studierenden auch beim Aufbau von KI- und Digitalkompetenzen, etwa Digitaler Ethik, durch innovative Lehrformate bereits jetzt bestmöglich zu unterstützen.“ News4teachers
Die Aufbereitung der Ergebnisse in einem DatenCHECK im Portal hochschuldaten.de ermöglicht hierbei in interaktiven Grafiken sowohl eine Übersicht für einzelne Fächer sowie die Filterung nach einzelnen Future Skills im Fächervergleich.
Digitale Kompetenzen: Wirtschaft beklagt Defizite bei Schülern – Schüler zeigen auf die Lehrkräfte










Die chaotische Lehre gerade in den mathelastigen Fächern behindert schon enorm den Erwerb von Fachkompetenz. Da fällt die Entwicklung der future skills noch schwerer.
Problemlösekompetenz, kritisches Denken und Kollaboration.
Mathematik (Problemlösen), kritisches Denken (Deutsch) und an Klassen- und Gesprächsregeln halten (Kollaboration) sind wirklich wichtige Future Skills.
Resilienz erlangen die Kinder indem sie anspruchsvolle Aufgaben angehen und meistern.
Entscheidungskompetenz kommt dann später beim selbstorganisierten Lernen und Problemlösen dazu.
“Entscheidungskompetenz kommt dann später beim selbstorganisierten Lernen und Problemlösen dazu.”
Gerade eben nicht. Diese selbst- dies und das kann ich seit der Grundschule nicht mehr hören. Keiner zeigt diesen Kinder, WIE das Selbsorganisation und Problemlösen überhaupt geht und zwar durch die ganze Bildungszeit nicht. Durch den Stoff jahrelang zu pauken und wiedergeben? Das Kind muss einfach es können und dann kommt – wenn das Kind nicht kann, ist nicht für diese Schule. Und in dieser Schule lernt man nichts weiter, als den Stoff wiederzugeben und das genau so, wie dem Kind gesagt wird und von ihm genau auf diese eine einzige Art und Weise verlangt wird – und so gleich für alle Kinder. Genau wie vor 60 Jahren noch. Und wer genau das gut kann, kann auch auf dieser Schule gute Noten schreiben. Nur die Arbeitswelt braucht keine gute Noten, sie sind nur Beweis für die gute Kurzzeitgedächtnis. Mit der Entscheidungskompetenz wird das Kind nicht geboren, das ist etwas wofür man Jahrelang trainiert werden muss, und zwar um die richtige und angemessene Entscheidung zu treffen, nicht nur Entscheidungen treffen zu können – und genau da hackt – das selbstorganisierten Lernen und Problemlösen dazu, als Beweis für Entscheidungskompetenz, hat gar nichts gemeinsames mit Entscheidungskompetenz in der Arbeitswelt.
Eine richtige und angemessene Entscheidung kann man nur unter der Vorraussetzung treffen, dass man über Selbstkontrolle und ausreichendes Wissen verfügt um die Konsequenzen der Optionen abschätzen zu können.
Das gilt für alle Lebensbereiche.
Früher sollte man in Deutsch-Aufsätzen nicht irgendwas Gelerntes wiederzugeben, sondern man sollte selber argumentieren. Dazu durfte man auch eine eigene Meinung haben. Nicht die Meinung wurde zensiert, sondern der Stil der sprachlichen Ausführungen. Heute wird viel mehr vorgegeben.
Beispiel für ein Aufsatzthema: “Entwerfen Sie eine Rede des griechischen Finanzministers vor den EU-Geldgebern.” Im Klartext: Die Meinung wird vorgegeben.
Entscheidungskompetenz ist gut – da ich mich ja auch gegen etwas entscheiden kann.
Oh Mann, was sind denn “future skills”. Bitte schließt mich nicht aus. Gab es das früher nicht, als die Mehrheit noch Deutsch sprach? Wie redeten wir damals über sowas??
Gar nicht (was ein Teil des Problems sein könnte). Was Future Skills sind – übrigens ein längst eingeführter Fachbegriff – wird im Beitrag ausführlich erklärt. Herzliche Grüße Die Redaktion
Aber es fehlt auch im Ansatz die Erläuterung, warum diese “Future Skills” nicht schon in den letzten Jahrzehnten genauso wichtig waren. Es entsteht der Eindruck von Beliebigkeit, irgendwas dazu zu zählen oder auch nicht. Selbstorganisation war schon immer wichtig, Resilienz auch. Beides brauchte man, um Abitur zu machen und zu studieren. Kritisches Denken war — außer in Diktaturen — auch immer wichtig. Das gab es schon in der Antike.
Früher lernten Menschen einen Beruf, den sie bis zur Rente behielten. Sie waren in festen Hierarchien und fixierten Kompetenzbereichen tätig. Das industrielle Wirtschaften war auf Reproduktion ausgelegt. Das sind Rahmenbedingungen, die immer seltener gelten – aufgelöst vor allem durch die Digitalisierung, beschleunigt nochmal durch den Einsatz von KI. Ein zentraler Unterschied ist auch, dass Wissen früher relativ statisch war. Nach Ausbildung oder Studium hatte man weitgehend ausgelernt. Heute ahnen wir nicht einmal, welche Fertigkeiten in fünf Jahren gefragt sein könnten, so schnell vollzieht sich die technologische Entwicklung. Deshalb gibt es auch keine festgelegten Future Skills, sondern allenfalls Grundkompetenzen, die absehbar gefordert sein werden, vor allem: dauerhafte Flexibilität.
“Die Twin Transition, also die Transformation hin zu mehr Digitalisierung und Nachhaltigkeit, erfordert von den Beschäftigten ihre Kompetenzen stetig zu erweitern, um am Arbeitsmarkt anschlussfähig zu bleiben. Ebenso sind Unternehmen darauf angewiesen, ihre Beschäftigten weiterzubilden, um ihren Fachkräftebedarf zu decken.
Es gibt kein einheitliches Konzept von Future Skills am Arbeitsmarkt. Die Definitionen von Future Skills reichen von allgemeinen Werten bis hin zu Kompetenzen und konkreten Fähigkeiten. Manche Studien beziehen sich allein auf überfachliche Kompetenzen, wie Resilienz und Eigeninitiative, während der Fokus in anderen Studien auf fachlichen Kompetenzen, wie z. B. dem Programmieren und Softwareentwicklung, liegt. Der Forschungsstand zeigt jedoch, dass häufig ein Mix aus berufsfachlichen und überfachlichen Future Skills als arbeitsmarktrelevant identifiziert wird. Beschäftige in der Metallbranche mussten beispielsweise den Umgang mit automatisierten CNC-Maschinen erlernen, nachdem diese die handgeführten Drehmaschinen weitestgehend ersetzt hat. Dieser Wandel erfordert neben neuen fachlichen IT-Kompetenzen auch Kompetenzen wie Lernfähigkeit und interdisziplinäres Denken. Mit Blick auf den Forschungsstand wird außerdem deutlich, dass digitale Fachkompetenzen sich nicht mehr klar nach Branchen differenzieren lassen. Künstliche Intelligenz und damit verbundene Kompetenzen, wie Big Data Analysis, sind nicht nur in IT-Berufen stärker gefragt als noch vor wenigen Jahren, sondern u. a. auch in der Industrie, im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung. Neben überfachlichen und fachlichen Skills, die häufig digitale Kompetenzen umfassen, werden auch Green Skills immer öfter als Future Skills verstanden.” Quelle: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/beschaeftigung-im-wandel/future-skills
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ist doch klar wie Kloßbrühe. Das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten (sorry ich bin schon älter und weiß dennoch, dass das angeblich Kompetenzen sind), die in der Zukunft gebraucht werden – im Hier und Jetzt also ohne Belang sind. Wenn ich sie für die Zukunft brauche, kann ich mich auch noch morgen drum kümmern:)
Früher waren Fachbegriffe lateinisch oder griechisch heute sind sie englisch.
Wieso haben Sie damit ein Problem?
Es wird immer noch nur um den Test zu bestehen unterrichtet, wie vor 60 Jahren. Jede Menge Unnötiges frisst den Schüler und Studenten die Zeit. 12-13 Jahren, plus Studienzeit, also mind. 17-18 Bildungszeit und am Ende wissen sie kaum noch etwas um die Arbeitswelt zu betreten. Wiedergabe des Stoffes braucht noch keiner in realem Leben, genau so wenig wie Transferwissen in der Sinne – die Aufgabe anders gestellt. Die Zeiten – tue genau das, was dir gesagt wird – sind schon längst vorbei.Darüber beklagt sich Wirtschaft. Und dank dem Plus Programm unterrichtet keiner mehr, sondern begleitet – wie soll das bitte sehr funktionieren? Die Kinder und Studenten sollen sich neben des Stoffes noch alle nötige Fähigkeiten für die Arbeitswelt wohl selbst beibringen, oder?
„Absolventen müssen später im Berufsleben heute noch unbekannte, komplexe Probleme in heterogenen Teams lösen und neue technologische Entwicklungen in ihren Berufsalltag integrieren können.”
Nein – Doch – Oh. Das war ja früher komplett anders. Wenn ich mal den Informatikunterricht der 80er und das Studium in den 90ern betrachte, dann beschleicht mich der Verdacht, dass ich mich seitdem in gaaanz viele, damals noch unbekannte technologische Entwicklungen einarbeiten musste. Das klappt übrigens hervorragend, wenn man keine Kompetenzen hat, sondern – Achtung – “Grundwissen”. Dann alle neue Technik kommt ja nicht aus dem Nichts. Das fehlt mir übrigens etwas bei den “future skills”.
Wenn ich die Future skills durchlese, komme ich auf den Gedanken, dass ein gewisser Anteil von Behinderten aber auch Alten immer weniger inkludiert werden wird, da dass oft Menschen sind, die einfach nur in Ruhe ihren Job machen wollen.
Ich selbst sehe wenig Vorteil in den Future skills, weil sie vermutlich die Tür dazu öffnen, dass Self Marketing und vorteilhafte Vernetzung gegenüber Kompetenz gewinnen.
Dann stürzen Brücken eben mal ein, war im multikulturellen, dialogkompetenten Team halt kein Bauingenieur dabei.
Wie immer plädiere ich für die Leisen und wenig Chicen.
Wenn jemand Vorschläge hätte, diese Tendenz zu verhindern, gerne. Per se ist nicht alles Neue schlecht, nur wie man heutzutage gerne sagt, noch in der Beta-Version.
Und so kommt der Frischling mit allen Einser ins Büro und kann nicht die einfachste Bürokram verstehen, weil das eben nicht im Buch steht und noch weniger ist er in der Lage über den Tellerrand zu blicken, weil er darauf nie, die ganze Bildungszeit nicht, vorbereitet ist. Einer, der von städtischen Bildungseinrichtungen kommt, hat kaum noch als wenigstens Projektmitarbeiter eine Chance. Als Projektleiter schon gar nicht. Die Wirtschaft hat weder Zeit noch Geduld den Frischling noch extra 5-10 Jahren zu unterrichten. Lieber holt sich jemanden aus Indien her, der noch dazu weniger kostet.