DÜSSELDORF. Das Schulministerium will mit mehr Tests, Feedbacks und Zielvereinbarungen die Qualität der Schulen in Nordrhein-Westfalen verbessern. Doch der Philologenverband warnt: Daten allein machen noch keine gute Schule.
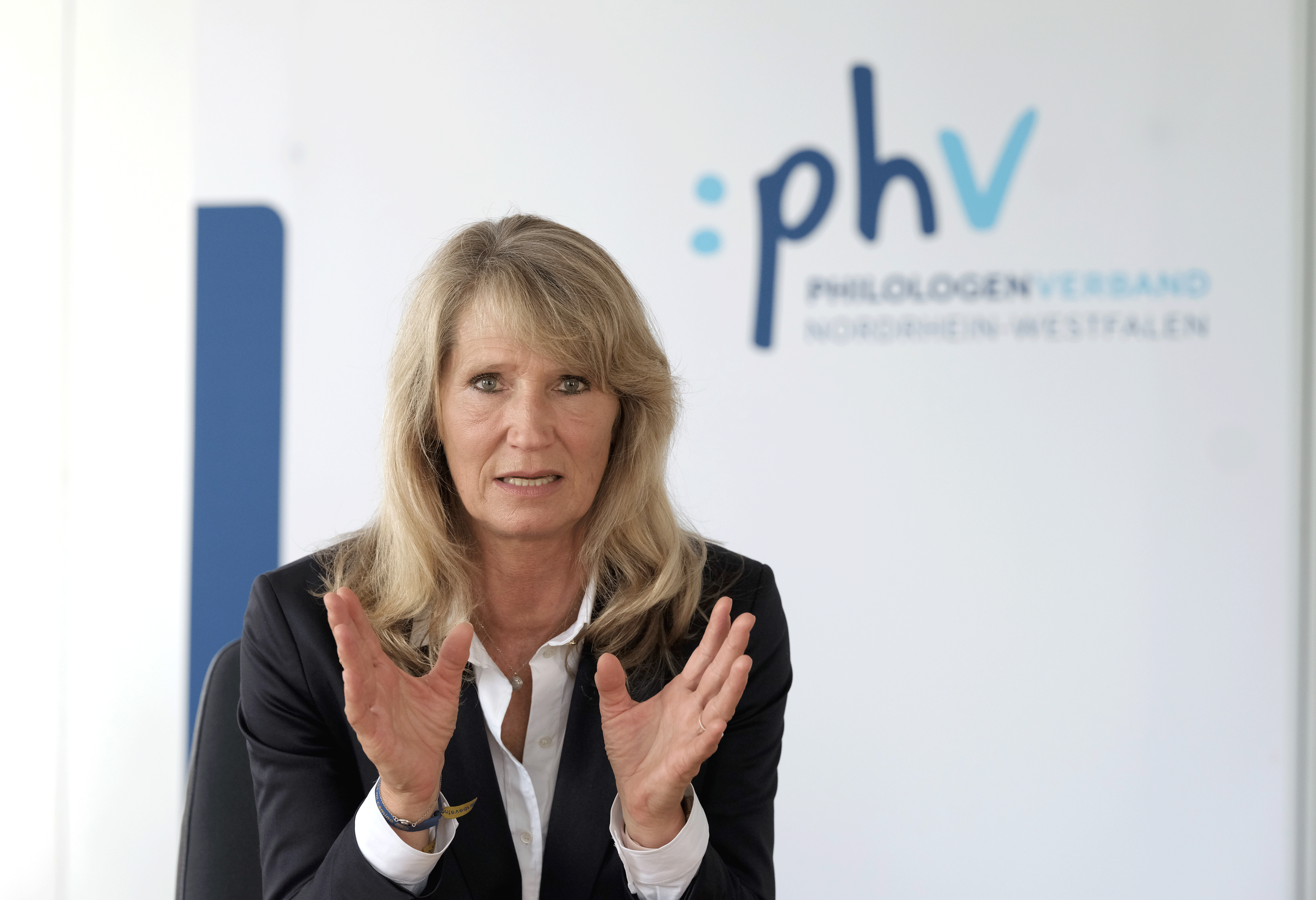
Nordrhein-Westfalen steht bildungspolitisch unter Druck. In den jüngsten PISA- und IQB-Studien schnitten Schülerinnen und Schüler aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland besonders schlecht ab – mit weiter fallender Tendenz. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) spricht offen vom „Tiefpunkt eines seit 2011 anhaltenden Negativtrends“ und will nun entschlossen gegensteuern: mit dem „Schulkompass NRW 2030“.
Das Konzept, das vergangene Woche vorgestellt wurde, setzt auf datenbasierte Schulentwicklung, neue Lernstandserhebungen, systematische Feedbacks von Schülern – und Zielvereinbarungen zwischen Schulen und Schulaufsicht. Der nordrhein-westfälische Philologenverband (PhV NRW) sieht die grundsätzliche Zielrichtung des Schulkompasses zwar positiv. Die Vorsitzende Sabine Mistler sagt: „Es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Doch sie warnt zugleich vor einer Überfrachtung der Schulen mit unrealistischen Erwartungen.
So werde etwa mit den Lernstandserhebungen der Eindruck erweckt, man könne daraus direkt auf die Unterrichtsqualität schließen. Das sei jedoch „nicht zulässig“, betont Mistler. Denn die Leistungen der Schüler seien nun mal auch von vielen anderen Faktoren abhängig – etwa Konzentrationsfähigkeit, Motivation oder Ablenkung durch digitale Medien. Sie betont: „Vergleichsarbeiten dürfen keinesfalls dazu benutzt werden, einseitig die Verantwortung für den Lernerfolg nur bei den Lehrkräften zu suchen. Diese liegt ebenso bei den Lernenden selbst und den Erziehenden.“
Ein weiteres Problem sei der zu erwartende Mehraufwand für die Lehrkräfte. Die bisherige Vergleichsarbeit VERA 8 sei, wenn nicht bereits digitalisiert, sehr aufwendig. Und: „Es werden Daten erhoben, aus denen derzeit keine konsequenten Ableitungen für die individuelle Förderung hergeleitet werden.“
Kritik an geplanten Zielvereinbarungen: Druck auf Schulen steigt, Ressourcen fehlen
Besonders kritisch sieht der PhV NRW die geplanten Zielvereinbarungen zwischen Schulen und Aufsicht. Mistler warnt: „Mit den Zielvereinbarungen steigt der Druck auf die Schulen enorm, was ich für sehr problematisch halte.“ Die geforderten Zielsetzungen stünden in keinem Verhältnis zu den vorhandenen Ressourcen bei Lehrkräften, Schulleitungen und Behörden. Was es stattdessen brauche, seien „bessere Fördermaßnahmen, mehr Unterstützung sowie bessere Rahmenbedingungen der schulischen Arbeit“.
Auch das geplante Schülerfeedback sieht der Verband differenziert. Zwar sei Feedback ein wichtiges Element professionellen pädagogischen Handelns – viele Lehrkräfte würden es ohnehin bereits einholen. Aber: „Die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte darf nicht infrage gestellt werden, sie ist ein hohes Gut des Lehrerberufs.“ Deshalb müsse klar geregelt werden, welche Daten erhoben werden und wie mit ihnen umzugehen sei – eine Bewertung einzelner Lehrkräfte dürfe nicht erfolgen.
Hintergrund:
Die Ziele des Schulkompasses klingen ambitioniert:
- Den Anteil der Schülerinnen und Schüler senken, die die Mindeststandards nicht erreichen.
- Den Anteil erhöhen, die die Optimalstandards erreichen.
- Die sozial-emotionalen Kompetenzen stärker in den Fokus rücken.
- Mehr junge Menschen zu einem Abschluss an Berufskollegs mit „Anschlussperspektive“ führen.
Um diese Ziele zu erreichen, soll die Datenerhebung an den Schulen massiv ausgeweitet werden. Drei zusätzliche Lernstandserhebungen in den Klassen 2, 5 und 7 kommen zu den bereits bestehenden VERA-Tests (Klassen 3 und 8) und den ZP10-Prüfungen hinzu. Diese sollen laut Ministerium bis 2030 schrittweise eingeführt werden. Dazu kommen Schülerbefragungen über ein digitales Portal sowie jährliche Zielvereinbarungen zwischen Schulen und Schulaufsicht. Ergänzt wird das Paket durch ein digitales Screening zur Erfassung der Lernstände bereits bei der Anmeldung in der Grundschule sowie durch ein geplantes digitales Dashboard mit schulspezifischen Daten.
Mit seiner Kritik steht der PhV nicht allein. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW betont: Tests allein helfen nicht. „Tests allein verbessern keine Kompetenzen, wenn niemand da ist, um die Ergebnisse in individuelle Fördermaßnahmen umzusetzen“, sagte Landeschefin Ayla Celik. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE NRW) fordert: Aus der Datenerhebung müsse eine gezielte Förderung erfolgen – sonst sei alle Analyse sinnlos. Die Realität an vielen Schulen sei eine Mangelverwaltung: Es fehle an Personal und kleineren Lerngruppen.
Auch der Verband lehrer nrw warnt vor einem erheblichen Mehraufwand für Lehrkräfte. Diese müssten aus den Ergebnissen schließlich Maßnahmen ableiten – in einer Zeit extremen Lehrkräftemangels. „Das passt einfach nicht zusammen.“
Ministerin Feller räumt bereits ein, dass die Umsetzung angesichts von 5.400 Schulen in NRW (zum Vergleich: Hamburg hat rund 400) eine „große Herausforderung“ sei. Deshalb werde der Zeitraum für die Einführung bewusst auf fünf Jahre gestreckt. Auch sollten möglichst digitale Formate genutzt werden, um Lehrkräfte zu entlasten. Die PhV-Landesvorsitzende Sabine Mistler bringt es auf den Punkt: „Lernerfolg und Unterrichtsqualität lassen sich nicht allein per Datensammlung und Zielvereinbarungen erreichen.“ News4teachers / mit Material der dpa










Die Ziele sind einfach umsetzbar:
Mindeststandards senken
Aus den heuten Mindeststandards die Optimalstandards machen.
Fachwissen durch sozial-emotionale Kompetenzen ersetzen.
neuen Abschluss am Berufskolleg unter dem heutigen niedrigsten Abschluss erfinden.
Zack fertig, Bildungsrepublik Deutschland erfüllt statistisch höchste Standards ohne nennenswerte Mehrarbeit.
So sieht es aus!
Klingt wie ein Plan.