DETMOLD. Vor mehr als hundert Jahren hatte ein Lehrer im Sauerland eine Idee, die Millionen Kinder und Jugendlichen bis heute prägt: die Jugendherberge. Einst als Wanderstützpunkt gedacht, sind sie heute Bildungsorte, Wirtschaftsfaktor – und stehen vor enormen Sanierungsaufgaben.

Es war der 26. August 1909, als ein Lehrer im Sauerland eine Eingebung hatte, die die Freizeit- und Bildungskultur in Deutschland und weit darüber hinaus verändern sollte. Richard Schirrmann, Pädagoge an der Nette-Schule in Altena, war mit seinen Schülern auf einer achttägigen Wanderung Richtung Aachen unterwegs. Die erste Nacht verbrachte die Gruppe in einer Scheune, freundlich aufgenommen von einem Bauern, der ihnen Decken, Pflaumen und Milch reichte.
Doch am zweiten Abend, im Bröltal, änderte sich die Szenerie dramatisch: Ein Gewitter zog auf, Blitze zuckten, der Regen prasselte, und der Bauer, den sie dort um Unterkunft baten, war wenig entgegenkommend. Schließlich erhielten die Wanderer etwas Stroh und fanden Zuflucht in einer leerstehenden Dorfschule.
Schirrmann erinnerte sich später eindringlich an diese Nacht: „Das Unwetter tobte während der ganzen Nacht mit Blitz und Donnerschlag, mit Sturm und Wolkenbruch und Hagelprasseln, als wenn die Welt untergehen sollte. Während die wandermüden Jungen fest schliefen, lag ich hellwach… Plötzlich überfiel mich der Gedanke: Jedem wanderwichtigen Ort in Tagesmarschabständen gleich Schule und Turnhalle auch eine gastliche Jugendherberge zur Einkehr für die wanderfrohe Jugend Deutschlands ohne Unterschied.“
Damit war die Geburtsstunde der Jugendherbergsidee gekommen. Ein Jahr später legte Schirrmann seine Vision in einem Aufsatz in der „Kölnischen Zeitung“ dar. Er forderte darin „Volksschülerherbergen“ – also Unterkünfte nicht nur für privilegierte Gymnasiasten, sondern auch für Kinder aus Arbeiterfamilien: „Auch die Knaben und Mädchen des gemeinen Mannes müssen frischfröhliches Wandern als Gegengewicht für die Stubenhockerzeit ihrer Schuljahre üben. … Jede Stadt und fast jedes Dorf hat eine Volksschule, die in den Ferien mit leeren Räumen geradezu darauf wartet, in einen Schlaf- und Speisesaal für wanderlustige Kinder verwandelt zu werden.“
Der Text löste eine Welle der Begeisterung aus: Schirrmann erhielt Geld- und Sachspenden aus ganz Deutschland. 1914 eröffnete in der Burg Altena die erste ständige Jugendherberge – mit Schirrmann selbst als Herbergsvater.
Wie prägten 1960er bis 1980er Jahre die Jugendherbergen?
Mit dem gesellschaftlichen Umbruch der 1960er und 1970er Jahre veränderten sich auch die Jugendherbergen grundlegend. Aus den Wanderungen von Haus zu Haus wurde die Klassenfahrt mit längerem Aufenthalt in einer Jugendherberge – ein völlig neues pädagogisches Konzept. Die Anforderungen stiegen: Kleine, heimelige Häuser, die einst als Wanderstützpunkte dienten, wurden geschlossen, größere Einheiten geschaffen und hauptamtliche Herbergseltern eingestellt.
Das Selbstverständnis dieser neuen Rolle fasste man damals so: „Die hauptamtliche Aufgabe von Mann und Frau als gleichberechtigte Teile der Herbergseltern-Familie setzt bei beiden eine jugendnahe, hilfsbereite und duldsame, menschliche Grundhaltung voraus […] Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Herbergsvater handwerklich oft zur Selbsthilfe greift […] Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Musische Begabung, das heißt die Fähigkeit, ein Instrument (Gitarre, Laute, Ziehharmonika) zur Begleitung von Liedern und Tänzen zu spielen, wäre wünschenswert.“
Gleichzeitig wuchs der Anspruch der Jugendlichen: Mehr Rückzugsmöglichkeiten, mehr Komfort, mehr Privatsphäre. Während Strohsäcke und Pumpen im Hof früher noch Alltag waren, verlangten die Gäste in Zeiten steigenden Lebensstandards nach modernen Zimmern und Sanitäranlagen.
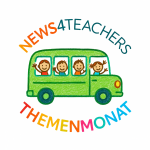 In den 1970er und 1980er Jahren weiteten die Jugendherbergen ihr Angebot stark aus. Neben Klassenfahrten kamen Jugend- und Familienerholung, Bildungs- und Tagungsstätten sowie internationale Begegnungen hinzu. Kommunale Zuschüsse und Bundesmittel förderten den Ausbau neuer Häuser, doch sinkende Geburtenzahlen führten bald zu rückläufigen Übernachtungszahlen. Mitte der 1980er war das DJH gezwungen, sich neu aufzustellen: kürzere Aufenthalte, Sanierungen, ein moderneres Erscheinungsbild – und erstmals auch zielgruppenspezifisches Marketing: Lehrkräfte (zum Beispiel) werden seitdem umworben.
In den 1970er und 1980er Jahren weiteten die Jugendherbergen ihr Angebot stark aus. Neben Klassenfahrten kamen Jugend- und Familienerholung, Bildungs- und Tagungsstätten sowie internationale Begegnungen hinzu. Kommunale Zuschüsse und Bundesmittel förderten den Ausbau neuer Häuser, doch sinkende Geburtenzahlen führten bald zu rückläufigen Übernachtungszahlen. Mitte der 1980er war das DJH gezwungen, sich neu aufzustellen: kürzere Aufenthalte, Sanierungen, ein moderneres Erscheinungsbild – und erstmals auch zielgruppenspezifisches Marketing: Lehrkräfte (zum Beispiel) werden seitdem umworben.
Warum sind Jugendherbergen auch heute noch so wichtig?
Was 1909 im Sauerland begann, wurde zur weltweiten Bewegung: Unter dem Dach von Hostelling International gehören heute rund 3.000 Häuser in fast 90 Ländern dazu – von New York über die norwegischen Fjorde bis nach Tokio. Rund 400 Häuser betreibt das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) bundesweit – mehr als 80 Prozent davon im ländlichen Raum oder in kleineren Städten. Sie bieten nicht nur günstige Übernachtungen, sondern sind Orte der Begegnung, der Bildung und der Gemeinschaft. Klassenfahrten, Familienurlaube, Chorfreizeiten oder internationale Austauschprogramme: Die Herbergen bleiben für viele junge Menschen der erste Schritt in die Welt ohne Eltern.
Doch die Bedeutung geht über das Pädagogische hinaus. Eine aktuelle Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr belegt, dass jeder in einer Jugendherberge erwirtschaftete Euro einen zusätzlichen Euro Umsatz in der Region erzeugt. Zudem schafft ein Arbeitsplatz im DJH rechnerisch 1,5 weitere Stellen vor Ort. Der wirtschaftliche Effekt wird auf mehr als 1,12 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt – ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor, gerade in strukturschwachen Regionen.
Trotz eines leichten Rückgangs der Übernachtungszahlen 2024 – rund 9 Millionen Gäste wurden gezählt, 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr – ist die Treue groß. Der Rückgang hat Gründe: 2023 hatten noch viele Schulen Klassenfahrten nachgeholt, die während der Corona-Lockdowns ausgefallen waren. Dieser Sondereffekt fiel im Jahr darauf weg. Ende 2024 zählte das DJH dennoch fast 2,4 Millionen Mitglieder, Tendenz steigend. „Diese Treue und das Vertrauen in unser Angebot bestärkt uns darin, dass unser vielseitiges Engagement nach wie vor als wichtig und richtig wahrgenommen wird“, betont DJH-Hauptgeschäftsführer Oliver Peters.
Welche Herausforderungen bedrohen die Zukunft der Jugendherbergen?
Doch die Erfolgsgeschichte steht vor einem kritischen Punkt. Viele Jugendherbergen sind in historischen Gebäuden untergebracht – Burgen, Schlösser, alte Bauten. Ihre Sanierung, insbesondere im Zuge der Energiewende und für barrierefreien Umbau, erfordert enorme Investitionen. Peters macht deutlich: „In den nächsten acht bis zehn Jahren müssen wir rund 30 Millionen Euro pro Jahr investieren. Da ist es nicht damit getan, dass wir eine Heizung austauschen.“
Das Problem: Als gemeinnütziger Verband darf das DJH keine großen Gewinne erwirtschaften und keine hohen Rücklagen bilden. Ohne staatliche Unterstützung seien deshalb gerade Häuser im ländlichen Raum gefährdet. „Ist das nicht der Fall – da müssen wir offen und ehrlich sprechen – werden wir Häuser gerade im ländlichen Raum nicht über die nächsten Jahre weiterführen können“, warnt Peters.
Was bleibt von Schirrmanns ursprünglicher Vision?
Die Jugendherbergen stehen damit an einem Scheideweg: zwischen einer großen Tradition und der Herausforderung, ihre Zukunft zu sichern. Es lohnt, an den Ursprung zu erinnern – an jenen Lehrer, der in einer stürmischen Nacht den Gedanken fasste, jungen Menschen eine sichere Unterkunft und damit ein Stück Freiheit und Gemeinschaft zu ermöglichen. Damit Richard Schirrmanns Anspruch nicht verblasst: „Jedem wanderwichtigen Ort in Tagesmarschabständen gleich Schule und Turnhalle auch eine gastliche Jugendherberge zur Einkehr für die wanderfrohe Jugend Deutschlands ohne Unterschied!“ News4teachers
Die Jugendherberge Burg Altena bietet sich bis heute als Zielort für Klassenfahrten an.
Neues Redaktionskonzept bei News4teachers: Mehr Tiefe, mehr Praxisbezug – Themenmonate starten






