MÜNCHEN. Das Schulsystem in Bayern muss sich nach Ansicht des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) und des Bayerischen Elternverbands (BEV) grundlegend verändern. Es brauche eine andere Form des Lernens und ein anderes Leistungsverständnis, fordern BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann und die stellvertretende Vorsitzende des BEV, Angela Wanke-Schopf, in der Süddeutschen Zeitung. An diesem Dienstag beginnt in Bayern das neue Schuljahr.

„In unserer bayerischen Gesellschaft leben wir einen scharfen Leistungsbegriff, viele sind unterwegs in dem Kontrollwahnsinn“, sagt Fleischmann. „Alternative Formen der Leistungserhebung, die gibt’s aber schon, die stehen in den Lehrplänen, aber das trifft den Mainstream-Geschmack der Söderianer nicht.“
Hintergrund: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im vergangenen Herbst per Machtwort das Fortbestehen der unangekündigten Tests verkündet. Nach Angaben des Kultusministeriums wird es die bei vielen Schülerinnen und Schülern besonders ungeliebten „Exen“ weiter geben. Es liegt aber weiterhin im Ermessen der Lehrkräfte, wie sie damit umgehen.
Wanke-Schopf sagt: „Wir vom BEV sind ganz klar für die Abschaffung der unangekündigten ‘Exen’ und dieses Abfragen, also dieses ‘An die Tafel holen und dann eine Viertelstunde oder halbe Stunde fragen, bis der Schüler die Nerven verliert und eine schlechte Note bekommt’.“ Es brauche eine andere Prüfungskultur. „Warum nicht individuelle Projekte machen und darüber einen Test schreiben? Warum sollen die Lehrer nicht im Gespräch Noten machen?“, fragt Wanke-Schopf. „Brauchen wir Noten überhaupt? Ich finde, da sollte man viel größer denken.“
Kontrolle statt Motivation?
Fleischmann schlägt in dieselbe Kerbe: „Note, Schulaufgabe, Überraschungs-Ex sind Ausdruck eines Leistungssystems, das auf Kontrolle angelegt ist. Wenn du Schule unter der Überschrift Kontrolle lebst, dann passt das gut zusammen. Wenn du Schüler individuell begleiten willst, wenn du willst, dass sie Bock haben zu lernen und das ein Leben lang, dann ist der Blick mit der Kontrollbrille nicht richtig.“Auch BEV-Vertreterin Wanke-Schopf kritisiert das System: „Für mich gibt es keinen Grund, Kinder so in die Falle tapsen zu lassen. Wir müssen uns eine andere Prüfungskultur aneignen.“
Immerhin: Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) hat eine Arbeitsgruppe zur Prüfungskultur ins Leben gerufen, an der auch der BLLV beteiligt ist. Noch in diesem Schuljahr sollen erste Ergebnisse vorliegen. Fleischmann sieht darin eine Chance für mehr faktenbasiertes Handeln.
Sitzenbleiben und frühes Aussortieren
Dass Bayern nicht auf der Höhe der Zeit sei, zeige sich auch beim Sitzenbleiben, so Fleischmann. Pädagogisch sei das Wiederholen einer Klasse sinnlos: „Die zynische, fehlbenannte Ehrenrunde bringt nämlich genau das Gegenteil. Das Schlimmste dabei ist die Demotivation der Kinder.“ Stattdessen brauche es individuelle Förderung, sobald Lernschwächen erkannt würden. Auch das frühe und harte Aussortieren im Schulsystem sieht der BLLV kritisch. Die Durchlässigkeit sei in der Praxis eine Einbahnstraße nach unten: „Auf drei Absteiger kommt ein Aufsteiger! Ein längeres gemeinsames Lernen wäre eine wirkliche Lösung.“ Für Fleischmann reicht es nicht, an einzelnen Stellschrauben zu drehen: „Jetzt auf einmal sechs Jahre aus den vieren zu machen, bringt alleine nicht das, was wir wollen. Vielmehr muss sich das Lernen grundlegend ändern und somit das Leistungsverständnis.“
Als positives Beispiel nennt sie die Eichendorff-Mittelschule in Nürnberg-Erlangen, die durch offene Lernkonzepte, gute Diagnostik und angstfreies Lernen – gerade in Mathematik – großen Zuspruch erhält. Solche Schulen zeigten, dass individuelle Förderung funktioniert und auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt. Der Mangel an Lehrkräften verschärft die Situation allerdings zusätzlich. Um Nachwuchs zu gewinnen, müsse der Beruf attraktiver werden, fordert Fleischmann – mit besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal und gesellschaftlicher Wertschätzung. „Wir brauchen mehr begeisterte Lehrer“, sagt sie. News4teachers / mit Material der dpa
Bürgerrat-Talk über Schulnoten: Gerechter bewerten – oder bewährtes System behalten?








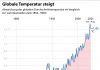

Den in dem Artikel zitierten Damen empfehle ich einen Umzug nach Rheinland- Pfalz.Hier sind unangekündigte Überprüfungen am ersten Schultag von Minister Teuber verboten worden.Das, was die Damen sich wünschen, strebt der Minister an, wie er glaubhaft versichert.Ich bin gespannt, ob und wie er das umsetzt.Ob es den Schülerinnen und Schülern langfristig nützen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.Ich habe meine Zweifel.Der Artikel ist leider wieder einmal sehr einseitig ausgefallen, enthält ohne Berücksichtigung einer Gegeneinung die typischen schulpolitischen Forderungen linker Parteien und Pädagogen.Bei Leistungsvergleichen schneidet Bayern bisher in der Regel viel besser ab als Rheinland- Pfalz.
// Bei Leistungsvergleichen schneidet Bayern bisher in der Regel viel besser ab als Rheinland- Pfalz. //
Nicht ohne Grund. Wer von Schülern keine Leistung einfordert, wird in der Breite auch keine Leistung bekommen. So simpel! Geschätzte 20-30% der Schüler sind in der Lage rein “intrinsich” motiviert ein Abitur abzulegen, der Rest muss extrinsisch motiviert werden.
Seit einigen Jahrzehnten wird aus bestimmten Kreisen ohne jeden Nachweis jedoch das Gegenteil propagiert. Leider haben diese Leute die Deutungshoheit übernommen. Und wenn es nicht funktioniert, brauchts einfach mehr von der süßen Medizin.
Das im Bildungsmonitor zweitbeste Bundesland soll also seine Erfolgsspur verlassen, weil Ideologen das so wollen. Mit besten Grüßen aus Baden-Württemberg kann ich davon nur abraten; wir wurden erst einmal nach hinten durchgereicht. Mich wundert es, dass BW inzwischen wieder auf Platz vier zu finden ist.
Der BLLV ist der größte Lehrkräfteverband in Bayern, zudem im dbb Beamtenbund organisiert, der BEV die Vertretung der organisierten Elternschaft im Freistaat – “Ideologen”? Schon schräg. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ich halte mich an die Prämisse: „Never change a running system“ oder: „Wenn etwas nicht kaputt ist, reparier es nicht.“
Der BLLV vertritt in erster Linie die Interessen der LEHRER. Nicht die der Schüler oder der Wähler. Auch nicht die der Gesellschaft. Das sollte auch die Redaktion wissen. Und da vertritt man eben die Dinge, die das Leben des Lehrers erleichtern (z.B. keine Korrekturen mehr von Exen usw..) und das, wass ein großer Teil der tendenziell eher linken Lehrer so glaubt. Ein Lobbyistenverein.
“Das sollte auch die Redaktion wissen.” Die Redaktion weiß, dass ein Lehrkräfteverband Lehrerinnen und Lehrer vertritt. Klar, ein “Lobbyistenverein” – wie jede Gewerkschaft. Die Redaktion weiß aber auch, dass der BLLV – und insbesondere Frau Fleischmann – durchaus in der Lage ist, Bildung über den engen Horizont der eigenen Bequemlichkeit hinaus zu betrachten. Darüber hinaus weiß die Redaktion, dass der BEV Eltern vertritt – und ihre durchaus legitimen Interessen.
Die Redaktion weiß allerdings nicht, dass Lehrkräfte “tendenziell eher links” wären – das halten wir für ein Gerücht (oder eine Frage der Perspektive: von Rechtsaußen aus ist alles links).
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Bei IQB 2021 4. Klasse belegten die Schüler*innen aus Bayern allerdings in den vier Kategorien nur 2 * Rang 1 , aber auch 2 * Rang 2 , bei IQB 2022 9. Klasse in den 5 Kategorien auch nur 3 * Rang 1, ebenfalls 2 * Rang 2.
Vielleicht ist man der Ansicht, dass die zweiten Plätze den unangekündigten Leistungsnachweisen geschuldet sind und es in Bayern eine Leistungsexplosion geben würde, wenn sie landesweit verboten würden?
Die Lernleistungen ließen sich verbessern , wenn die Schüler sehr viel zeitnäher eine Fehlerrückmeldung in Verbindung mit Hilfen durch die Lehrperson oder Mitschüler erhielten, damit Schwächen abgebaut werden können. Ohne eine derartige Hilfe bei einer weiterhin erteilten negativen Bewertung durch mangelhaft, ausreichend oder sogar ungenügend, erfahren die Schüler und Schülerinnen das Gefühl das negativ bewertete Fach nicht zu beherrschen, zu versagen, unfähig zu sein.
Finden diese Rückmeldungen nicht dauerhaft während des Unterrichts und in Übungsphasen statt? Wenn ich einen Blick in die Hefte meiner Kinder werfe, wird in Prüfungen nie etwas verlangt, was vorher nicht auch (mehrfach) geübt wurde.
Schon irgenwie wie seltsam, wenn Leute die sonst mehr Freiraum und Selbstverantwortung für Schulen fordern, hier plötzlich nach einem Verbot rufen.
Traut der BLLV denn den Schulen und Lehrkräften in Bayern nicht zu, selber beurteilen zu können, ob und ggf. wann und wie solche Dinge Sinn machen oder nicht? Dann wäre jetzt wohl eher Überzeugungsarbeit und Aufklärung gefragt statt solcher Forderungen, denn es sieht ja nicht so aus, dass ein Verbotsantrag in absehbarer Zeit ne Chance im Landtag hätte.
Die Freiheit der einen ist hier halt die Traumatisierung der anderen – da hört der Freiheitsgedanke auf!
Wäre dann natürlich wichtig künftig auch angekündigte Leistungsnachweise und deren Benotung abzuschaffen, denn was man so liest scheint ja auch das Schüler*innen unter immensen psychischen Druck zu setzen.
Ich sage mittlerweile:
Schafft es ab, streichen, streichen, streichen.
Was nicht benotet werden muss wird (über kurz oder lang) keinen interessieren, ergo: Weniger Arbeit.
Schafft es ab, streichen, streichen, streichen.
Was nicht benotet werden muss wird (über kurz oder lang) keinen interessieren, ergo: Weniger Arbeit.
Und was wäre das daraus folgende zu erwartende Ergebnis?
Antwort: Die Dummheit emnazipiert sich!
Richtig.
Und erst, wenn die Dummheit so weit ausprobiert wurde, dass es wehtut – wird sich grundlegend etwas verbessern.
Bayern ist das Land mit den wenigsten Kindern, die die Schule ohne Abschluss verlassen.
Anna Stolz ist nicht bei drr CSU.
Könnte man zwar meinen 🙂 – ist aber tatsächlich falsch. Haben wir korrigiert. Danke für den Hinweis. Herzliche Grüße Die Redaktion
Gerne
In unserer bayerischen Gesellschaft leben wir einen scharfen Leistungsbegriff, viele sind unterwegs in dem Kontrollwahnsinn“, sagt Fleischmann. „Alternative Formen der Leistungserhebung, die gibt’s aber schon, die stehen in den Lehrplänen, aber das trifft den Mainstream-Geschmack der Söderianer nicht.“
Nun, ganz Deutschland lebt nach der Schule im „Kontrollwahnsinn“. Es gibt kaum ein Produkt, für das es nicht unzählige Vorschriften gäbe, ohne die es nicht auf den Markt gebracht werden darf. Das schützt uns alle, vor Vergiftungen, Verletzungen und Scharlatanerie.
In jedem bayerischen Kuhstall sind Leistung und Kontrolle zu Hause. Da gibt es auch keine alternativen Formen der Leistungserhebung. Das würde auch den Mainstream- Geschmack der Käufer und Käuferinnen nicht treffen, die durch den Genuss der Produkte nicht erkranken wollen.
Diesen scharfen Leistungsbegriff gegenüber Produkten und Dienstleistungen haben auch schon Kinder und Jugendliche, die für ihr Taschengeld keinen Fake bekommen möchten, wenn sie das Original bestellt haben und die kein zweites Mal zu einem Fast Food Laden gehen, wenn es ihnen dort nicht geschmeckt hat, es nicht sauber war, die Bedienung ewig braucht, es zu teuer ist.
Die jungen Leute schreiben dann auch gerne Rezensionen oder stellen ein Video ins Netz, in dem sie von ihren Erfahrungen berichten.
Sie bewerten ohne Beschönigungen und scharf. Je nachdem bricht daraufhin der Wahnsinn über einem Shop herein oder aber es kommt niemand mehr und der Laden muss schließen.
In einer Zeit des Überflusses wird kontrolliert und scharf bewertet.
Junge Menschen, die damit aufwachsen, in der Schule davon auszunehmen, ist in meinen Augen nicht die richtige Vorbereitung auf ihr Leben. Sie selbst haben vielleicht Angst vor ihrem eigenen Anspruch Produkten und Dienstleistern gegenüber und der richtigen Annahme, dass sie und ihre Leistungen im späteren Berufsleben ebenso bewertet werden, wie sie selbst das tun.
Es geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung, in der Schule Leistungen unter Laborbedingungen herzustellen, die draußen nicht gelten und ich glaube, dass die jungen Menschen das wissen, auch wenn sie gerne in der Schule vor ihren eigenen hohen Ansprüchen anderen gegenüber für sich selbst noch beschützt sein wollen.
Ich erkenne im Vergleich von bayerischen, baden-würrtembergischen und rheinland-pfälzer Schulkindern keinen Unterschiede in der Motivation.
Große Unterschiede gibt es bei der Nachhaltigkeit des Lernens und der Konstanz.
Ich bin im Team Söder.
Rheinland- pfälzische bitte!
“Oh Heiliger Sankt Korinthus…!”
Die bayrischen Kinder üben wohl mehr.
Die Meinung des bayrischen Ministerpräsidenten Söder zu Schulnoten steht im direkten Widerspruch zu Stanislaw Dehaene. Sie entspringt meiner Meinung nach aus einer tradierten Gewohnheit, die er so in der Kindheit als Selbstverständlichkeit wahrnimmt.
Dehaene verwirft Noten als unnütz oder gar schädlich, weil sie als Feedback weder schnell noch präzise (im Hinblick auf einen konkreten Fehler) sind, sondern zeitverzögert und summativ Gesamtergebnisse erfassen. Somit würden Schüler bei schlechten Noten lernen, dass sie „eben kein Mathe können“ statt an konkreten Fehlern zu arbeiten („ich kann keine quadratische Gleichung lösen“).Der Lösungsansatz ist demnach die Schüler gezielt zu fördern, bis das Problem, quadratische Gleichung, verstanden und gelöst ist. Herr Voss sieht aber konträr dazu, da aus seiner Sicht Randnotizen der Lehrperson zur Aufgabenlösung eine sinnvolle Lösungsmöglichkeit darstellen, um den Lernenden eine Hilfestellung zu geben. Dadurch bleibt aber dennoch der negative Effekt einer “Bestrafung”, die sich negativ auf die Motivation auswirkt.
Nach Dehaene sind die vier Säulen des Lernens laut der Rezension von Herrn Voss.
1.Die Aufmerksamkeit ist das zentrale Tor, mit Sitz im Thalamus, durch das jede Information muss, die gelernt werden soll. Wenn etwas keine Aufmerksamkeit bekommt, wird es nicht bewusst und das neuronale Signal bleibt zu schwach, um einen bleibenden Lerneffekt zu erzielen. Das Konzept der Aufmerksamkeit umfasst dabei sowohl die Vigilanz („Wachheit“) als auch den bewussten Zugang (Verstärkung von Signalen, die bewusst, also mit allen Gehirnregionen, vgl. „globaler Arbeitsraum“ in „Denken: Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“, verarbeitet werden sollen und Abschwächung anderer Signale) sowie die Konzentration und Selbstkontrolle, die Aufmerksamkeit auf etwas ausgerichtet zu halten.
2.Es geht bei der aktiven Einbindung vielmehr darum, die Schüler in einer vorstrukturierten, interessant gestalteten Lernumgebung zu eigenen Ideen und Hypothesen anzuregen. Dazu gibt es viele verschiedene Wege – selbst ein gut gehaltener Vortrag vor interessierten Schülern, ggf. mit gelegentlichen Fragen ans Plenum, kann Schüler und Studenten aktiv einbinden. Gleichzeitig offenbart sich anhand der Erkenntnisse zum selbst entdeckenden Lernen, dass die Vorstellung von Digitales Natives ein Mythos ist – auf sich selbst gestellt werden Kinder zwar lernen, wie sie im Alltag mit Medien zurechtkommen, aber sie werden nicht von allein die abstrakten Strukturen dahinter entdecken und begreifen, die für die Funktionsweise von Medien so wichtig sind.
3.Um aber in komplexeren Situationen effektives Lernen zu ermöglichen, müssen Schüler schnelles und akkurates Feedback bekommen, das ihnen genau vermittelt, warum sie gestrauchelt sind und was sie stattdessen hätten tun können (dabei bezieht sich Dehaene auch auf die bekannte Hattie-Studie). Dies muss aber auf einem wertschätzenden und nicht bestrafenden Weg passieren, der klar macht, dass Fehler völlig normal sind – wer hingegen keine Fehler macht, wird auch nie etwas lernen. Die Angst vor Fehlern hingegen hemmt das Lernen stark. Allgemein lernen Schüler aus Erfolg mehr als aus Fehlern.
4.Zuletzt bleibt noch die Konsolidierung von Wissen als vierter Säule des Lernens. Neues Wissen muss in der Regel durch bewusste Übung erlernt werden, denn das Bewusstsein übernimmt als „globaler Arbeitsraum“ (siehe auch „Denken: Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“ von Dehaene) eine wichtige Funktion bei der Koordination und Kontrolle der unterschiedlichen Gehirnregionen. Die bewusste Verarbeitung hat aber den Nachteil, dass sie sehr langsam und anstrengend ist und dass nur wenige Inhalte gleichzeitig bewusst sein können. Höhere Lerninhalte, die auf anderen aufbauen, können daher erst erreicht werden, wenn die grundlegenden Lerninhalte ausreichend konsolidiert sind, sodass die bewusste Verarbeitung nicht mehr mit den Grundlagen beschäftigt ist. Die Grundlagen müssen bereits automatisiert sein, also unbewusst, mühelos und schnell verarbeitet werden, um Platz für die neuen Inhalte zu schaffen. Ein schönes Beispiel liefert Dehaene zum Lesen einer Mathematikaufgabe (auf „englisch“): „A dryver leevz Bawstin att too oh clok and heds four Noo Yiorque too hunjred myels ahwey. Hee ar eye-vz at ate oh clok. Wat waz hiz avrij speed?” (S. 223f.). Wenn das Lesen noch so langsam und mühsam wie bei einem Zweitklässler ist, kann man den mathematischen Gehalt der Aufgabe nicht erfassen.
Für die Konsolidierung von neuem Wissen ist Schlaf essenziell wichtig. Während des Schlafens wird das am Tag Erlebte noch mal neu und in beschleunigter Form immer wieder erlebt, sodass sich ein Trainingseffekt einstellt. Ebenso kann das Erlebte während des Schlafs generalisiert werden, sodass abstrakte Regeln und Muster deutlich werden.
Seien wir mal ehrlich, eine Schule ohne Noten kann es geben, aber nicht unter unseren Rahmenbedingungen. Man kann nicht weiter halbtags Schule machen und dann erwarten, dass die Kinder ohne den Leistungsdruck, der zurzeit durch Noten ausgeübt wird, schulische weiterkommen. Klar, anregende Umgebung, individuelle Lernwege und Lernbegleitung, alles denkbar, aber wenn die Kinder um 13.15 Uhr zuhause sind werden sie zocken, scrollen, chatten, aber sich sicher nicht mit Latein, Mathe oder Geschichte beschäftigen (Ausnahmen bestätigen hier wie wir wohl alle wissen die Regel). Daher ist Abschaffung von Noten zu kurz gedacht. Abschaffung des gegliederten Schulsystems, Einführung der Ganztagsschule (gestemmt durch welches Personal?), Verringerung der Klassengröße (Frage ist wieder mit welchem Personal) wären Grundvoraussetzung, dass das funktionieren könnte. Aber wir leben glaube ich lange genug in Deutschland um zu erkennen, dass so viel Veränderung auf einmal illusorisch ist, egal in welchem Bundesland. Ein reines Abgehen vom Leistungsgedanken ohne Aufbau eines die Schüler intrinsisch motivierenden Systems wird uns nach m. E. in PISA und Co und unsere Schüler insgesamt in ihrem Leben nicht weiterbringen.
“PISA und Co”
Wie macht man das denn in anderen Ländern, speziell denen, die gut bei PISA abgeschnitten haben? Und wie sind die Erfahrungen in jenen Ländern, die tatsächlich die Noten abgeschafft haben? Bei solchen Fragen wird immer erstaunlich absolut und moralisch argumentiert und nicht vergleichend mit den anderen Ländern. In Fernost gibt es jedenfalls nicht nur Noten, sondern auch große Aufnahmetests, deren Ergebnis über die weitere Zukunft entscheiden. Und dazu noch privaten Nachhilfeunterricht, um die Leistungen und die Noten zu verbessern.
Die Top-Plätze belegen Länder wie Singapur, Japan und Korea, wo viel Wert auf Leistung und Disziplin gelegt wird – genau die beiden Dinge, die man in Deutschland unbedingt gänzlich abschaffen will. Es kann nur super werden.