BERLIN. Milliarden fließen in den kommenden Jahren in die Schulen – über das Startchancenprogramm, einen neuen Digitalpakt und ein Investitionsprogramm des Bundes. Doch wer setzt die vielen Projekte eigentlich vor Ort um? Es sind die kommunalen Schulträger – und die stoßen dabei längst an ihre Grenzen. News4teachers widmet sich in einer vierteiligen Serie den Schulträgern und ihren Problemen. Teil eins: Was ein Schulträger alles leisten soll, was er womöglich gar nicht leisten kann.
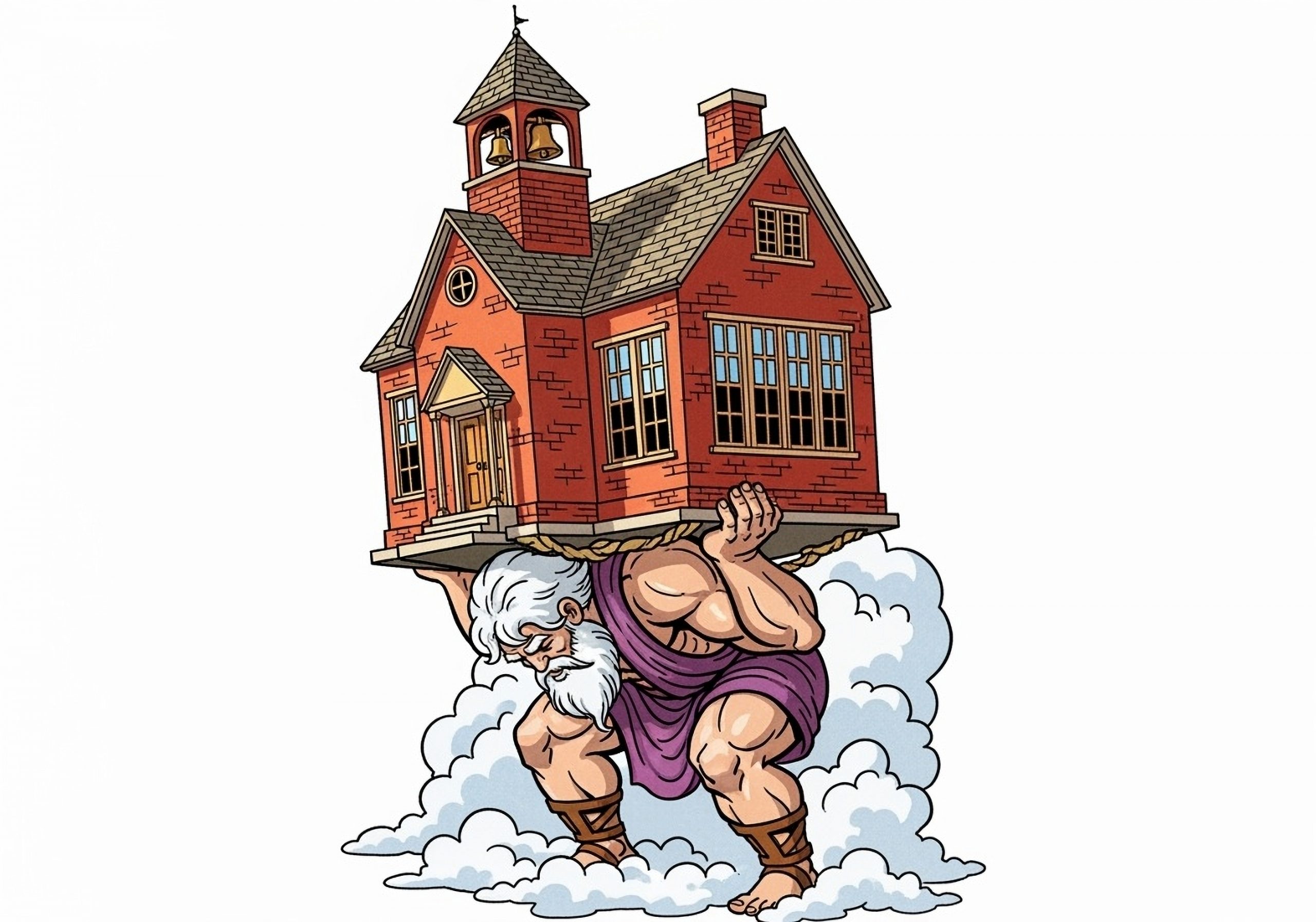
„Als Stadt bestreiten wir die äußere Schulträgerschaft, sind, vereinfacht gesagt, verantwortlich für Bänke, Stifte und Tafeln. Die innere Schulträgerschaft liegt dagegen beim Land, also die Unterrichtsgestaltung, die Personalbewirtschaftung, die Schulentwicklung.“ Mit diesen Worten beschreibt Christine Wolfer, Leiterin des Fachdienstes Jugend und Bildung der Stadt Jena, im Blog des Bildungsjournalisten Jan-Martin Wiarda ihre Aufgabe als kommunale Schulträgerin. Doch sie fügt gleich hinzu: „Dass diese Aufteilung nicht wirklich sinnvoll ist, hat der Städtetag schon 2007 in der sogenannten Aachener Erklärung festgestellt und umfassende Änderungen gefordert. Leider bis heute ohne Erfolg“.
![]()
 Digitale Tafeln: Investition oder Risiko?
Digitale Tafeln: Investition oder Risiko?
Wie erkennen Sie als Schulträger, ob sich ein interaktives Display wirklich für die Ausstattung Ihrer Schulen eignet?
Unsere Kunden geben eine klare Antwort: Service und Support sind entscheidend – aber der wahre Unterschied liegt in der Software.
Darum fließt das Feedback von Lehrkräften, Schulleitungen, Medienbeauftragten und kommunalen IT-Verantwortlichen direkt in die Weiterentwicklung von ViewBoard und myViewBoard ein. Gemeinsam mit der Universität Oldenburg testen außerdem Lehramtsstudierende die Tafel-Software im realen Unterrichtseinsatz.
ViewBoard + myViewBoard: eine nachhaltige Investition
- Offen & flexibel: Betriebssystemunabhängig, frei von kostspieligen Lizenzen, intuitiv nutzbar ohne lange Fortbildungen
- Service inklusive: umfassender Garantieschutz und schneller Support
- Software integriert: interaktive Tools für digitalen, ortsunabhängigen Unterricht
- Für alle: Funktionen, die schulische Inklusion und Integration unterstützen
- Einfach verwalten: einzigartiger Gerätemanager – spart Zeit, Energie und kann auch von Laien bedient werden
Gemeinsam mit ViewSonic Digitalisierung voranbringen!
Laden Sie hier unsere Broschüre herunter oder vereinbaren Sie direkt ein persönliches Gespräch mit uns: bildung@viewsonic.com
ViewSonic – Damit digitale Bildung wirklich funktioniert.
Hintergrund: Damals hatten die kommunalen Schulträger gefordert, die Verantwortung der Städte für die Bildung zu stärken. “Die Länder werden aufgefordert, kommunale Steuerungsmöglichkeiten insbesondere im Schulbereich zu erweitern und die Zuständigkeiten im Bereich der inneren und äußeren Schulangelegenheiten zugunsten der Kommunen neu zu ordnen. Zudem müssen sie die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen für ein erweitertes kommunales Engagement in der Bildung schaffen”, so hieß es im Wortlaut.
Schulträger zwischen Pflicht und Finanzkraft
Auch wenn die Erklärung folgenlos blieb – ein Überblick der Bertelsmann Stiftung macht deutlich, welche zentrale Rolle Schulträger trotzdem im deutschen Bildungssystem spielen. „Die Länder finanzieren durch die Übernahme der Kosten für Lehrerinnen und Lehrer das pädagogische Personal (innere Schulangelegenheiten), die Kommunen hingegen kommen für die Aufwendungen für Schulgebäude, Sportplätze, Schulbücher, aber auch digitale Endgeräte (äußere Schulangelegenheiten) auf“, heißt es in der Analyse.
Das bedeutet: Während die Länder die Inhalte verantworten, tragen die Kommunen die Infrastruktur. Dazu gehören Bau und Sanierung von Schulen, die Ausstattung mit Möbeln, Lehrmitteln und Technik, die Organisation des Schülertransports, die Reinigung der Gebäude – und vielfach auch der Ausbau von Ganztagsangeboten. Insgesamt gibt es mehr als 5.500 Kommunen in Deutschland, die als Schulträger auftreten – von der kleinen Gemeinde, die eine Grundschule verwaltet, bis hin zu kreisfreien Großstädten, die sämtliche Schulformen betreiben.
Die Finanzierung ist komplex und stark von der örtlichen Wirtschaftskraft abhängig. Gemeinden erheben Grund- und Gewerbesteuern, erhalten Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer – doch wie viel Geld tatsächlich in den Kassen landet, hängt davon ab, wie viele gutverdienende Bürger und florierende Unternehmen vor Ort ansässig sind. „Das bedeutet, dass in Städten, in denen viele gutverdienende Menschen leben, mehr Geld von der landesweit zur Verfügung stehenden Einkommenssteuer ankommt als in Städten mit hoher Arbeitslosigkeit, vielen Rentnern oder vielen Beschäftigten im Niedriglohnsektor“, so die Bertelsmann Stiftung. Zwar gibt es kommunale Finanzausgleiche, die Unterschiede mildern sollen, doch diese reichen vielerorts nicht aus.
Die Folge: „In finanzschwachen Kommunen steht Kindern häufig eine schlechtere schulische Infrastruktur zur Verfügung als in finanzstarken Kommunen.“ Gebührenunterschiede machen die Schieflage sichtbar: Während in einer Stadt Tablets für Schülerinnen und Schüler kostenlos gestellt werden können, zahlen Familien andernorts mehrere hundert Euro im Monat für Kita und Ganztagsbetreuung. Die KfW-Bank schätzt den bundesweiten Investitionsbedarf an Schulen mittlerweile auf 50 Milliarden Euro – eine Summe, die die kommunalen Haushalte bei weitem überfordert.
Wenn die Zuständigkeiten nicht mehr passen
Doch nicht nur fehlendes Geld ist ein Problem. Auch die klassische Aufgabenteilung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten stößt zunehmend an ihre Grenzen – insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung.
Mark Rackles, von 2011 bis 2019 Staatssekretär für Bildung in Berlin und designierter Bildungssenator von Bremen (SPD), erklärt auf dem Deutschen Schulportal: „Im Kontext der Digitalisierung von Schulen funktioniert diese Trennung nicht mehr. Hier ist ein Miteinander der verschiedenen Akteure zwingend erforderlich“.
Was das konkret heißt, illustriert er an einem Beispiel: „Nehmen wir ein IT-Gerät. Das ist nicht nur ein Ding, das wie ein Stuhl herumsteht, sondern es muss auch pädagogisch genutzt werden, und Lehrkräfte müssen mit ihm umgehen können. Ein IT-Endgerät kümmert es aber nicht, ob der Schulträger für die Anschaffung des Geräts, die Schulaufsicht für rechtliche Fragen, die Schulverwaltung für pädagogische Themen und die Schulleitung für den Datenschutz zuständig ist. Das kommt alles gleichzeitig mit dem Gerät zusammen und kann nicht getrennt gedacht werden.“

Rackles fordert daher eine „staatlich-kommunale Verantwortungsgemeinschaft“, in der Schulverwaltung, Schulträger und Schulleitungen verbindlich zusammenarbeiten. In Nordrhein-Westfalen sind dafür Bildungsnetzwerke und Bildungsbüros geschaffen worden. Dort verpflichten sich die Beteiligten, regelmäßig über Fragen wie Medienkonzepte, Softwareanschaffungen oder IT-Fortbildungen zu beraten. „Es ist ja nicht sinnvoll, wenn ein Schulträger die Software X und ein anderer Schulträger in der benachbarten Region die Software Y anschafft. Das Land müsste dann die Lehrkräfte für die Systeme X und Y fortbilden“, warnt Rackles. Der regelmäßige Austausch – mindestens vierteljährlich, bei Bedarf auch häufiger – sorgt für Koordination, Effizienz und gemeinsame Verantwortung.
Der erste Digitalpakt und seine Lehren
Wie groß die Schwierigkeiten sind, zeigt der Blick auf den ersten Digitalpakt Schule. Das Forum Bildung Digitalisierung hat in einer Expertise aufgearbeitet, warum viele Mittel zunächst nicht abgerufen wurden. Das Urteil ist deutlich: „Was bei der Umsetzung des Digitalpakts maßgeblich fehlt, ist eine digital-kompetente, Management-orientierte Begleitung der Schulen und des Gesamtprozesses, der von einer zentralen Instanz professionell koordiniert wird.“
Die Folge sei, dass Schulen und Schulträger mit den komplexen Anforderungen weitgehend allein gelassen wurden: „Mit Blick auf die komplexen Aufgaben der Digitalisierung ist mithin eine deutliche Management- und Organisationslücke im Schulsystem zu konstatieren.“
Das Forum formuliert deshalb klare Empfehlungen:
- Veränderungsmanagement auch für Schulträger: „Schulträger sind Mittler zwischen Schulen und Verwaltungsbehörden. Sie gestalten den digitalen Wandel maßgeblich mit und benötigen deshalb ebenfalls Hinweise, Information und Beratung, um ihrerseits Innovationsimpulse auszulösen und Veränderungen anzustoßen.“
- Leitlinien an die Hand geben: „Schulen und Schulträger brauchen Leitlinien im Hinblick auf IT-Ausstattung, Medienentwicklungskonzepte, rechtliche Rahmenbedingungen und didaktische Möglichkeiten des Lernens mit digitalen Medien.“
- Fortbildungskonzepte entwickeln: „Qualifizierung und Austausch sind wichtige Eckpfeiler bei der Umsetzung des digitalen Wandels. Die Angebote dazu sollten sich sowohl an Schulleitungen und Lehrkräfte als auch an Mitarbeitende in den Schulverwaltungen richten.“
- Einheitliches Vorgehen beim Datenschutz: „Insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Aspekte sind Schulen und Schulträger derzeit oft alleingelassen und überfordert. Hier wären Regelungen auf Landesebene […] eine große Erleichterung.“
- Experimentierfelder ermöglichen: Vorbehalte gegenüber digitalen Medien könnten nur überwunden werden, „wenn geschützte Räume geschaffen werden, die das Ausprobieren und Experimentieren ermöglichen.“
- Austausch organisieren: „Hier braucht es regelmäßige, regionale Austauschformate, die sich an alle Beteiligten im lokalen Bereich richten. Schulträger könnten hier die Rolle der Koordinatoren übernehmen, müssten jedoch entsprechend personell und finanziell ausgestattet werden.“
Eine Kommune wagt die Autonomie
Dass kommunale Spielräume trotz aller Vorgaben genutzt werden können, zeigt ein Beispiel aus Jena. Christine Wolfer berichtet: „Der Schulversuch hat uns erlaubt, drei Schulleitern, die sich auf den Weg machen wollten, besonders viel Bewegungsspielraum zu geben. Sie durften sich wie kleine Unternehmen selbst ihre Lehrkräfte aussuchen, die zu ihrem pädagogischen Profil passten, ohne dabei ferngesteuert zu sein über das staatliche Schulamt oder das Landesministerium.“
Damit trat der Schulträger aus seiner üblichen Rolle des Bauherrn und Verwalters heraus – und übernahm aktiv Verantwortung für die innere Schulentwicklung. „Die Schulen konnten sich entwickeln, sich personell vernetzen mit der städtischen Jugendhilfe, den Freizeitzentren, dem Stadtteilbüro. Was es ihnen möglich machte, ganze Familien in den Lernprozess einzubinden.“
Für Wolfer zeigt das Beispiel, wie mehr Autonomie im Zusammenspiel von Schulen und Schulträgern wirken könnte. Auch wenn die Kultusministerkonferenz den Versuch nach zehn Jahren beendete, bleibt für sie die Erfahrung: „Wenn wir Schule und Bildung wirklich neu denken wollten, müssten wir alle zu Änderungen bereit sein. Doch dafür müssten wir die Schulen zunächst stärken, indem wir sie mit zwei Leitungen ausstatten: einer pädagogischen und einer kaufmännischen.“ Entscheidungskompetenz also verlagern: an die Basis. News4teachers








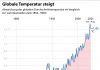

Also das können die Schulen doch selber umsetzen. Warum die übergeordneten Stellen mit Mehrarbeit überlasten. Wir schaffen das.
Es fordern doch alle mehr Autonomie für die Schulen. Also ran an die zusätzlichen Challenges Als Anreiz kann man doch mit ein paar zusätzlichen Beförderungsstellen garnieren – so als Möhre vor der Nase.