BERLIN. Sie fördern, bilden, trösten – und verdienen deutlich weniger als Lehrkräfte (auch dann, wenn sie studiert haben): Erzieherinnen und Erzieher kämpfen seit Jahren um mehr Anerkennung und eine gerechtere Bezahlung. Die Zeit greift das Thema aktuell auf – mit der Geschichte einer Kita-stellvertretenden Leiterin, die hart am Limit arbeitet und sich trotz akademischer Ausbildung und hoher Verantwortung nicht angemessen honoriert fühlt. Das Problem ist grundsätzlicher Natur.

„Ich verstehe nicht, warum ich so viel weniger verdiene als Lehrer.“ Levke Weikert (Name geändert), 30 Jahre alt, stellvertretende Leiterin einer Kindertagesstätte, liebt ihren Beruf – und ringt dennoch mit der Frage, wie lange sie ihn unter diesen Bedingungen noch ausüben kann. „Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht deutlich ändern, glaube ich nicht, dass ich diesen Beruf noch 20 Jahre mache“, sagt sie in einem nun in der Zeit erschienenen Protokoll.
Weikert beschreibt einen Alltag, der zwischen pädagogischem Anspruch und organisatorischer Dauerbelastung schwankt. „Ich betreue die Kinder, sitze aber auch viel im Büro und schließe Betreuungsverträge, erfasse Krankmeldungen, werte Statistiken aus“, erzählt sie. „Wenn ich die Tür zu meinem Büro schließe, geht sie nach ein paar Minuten wieder auf: Eine Kollegin braucht Hilfe, weil sich ein Kind übergeben hat, Eltern haben eine dringende Frage oder es sind so viele Kolleginnen krank, dass ich einspringen muss.“
Gerade in den Wintermonaten, sagt sie, sei immer jemand krank, „mehr Personal würde helfen“. Doch stattdessen wächst die Bürokratie: „Schulen haben ein Sekretariat, die Kita-Leiterin und ich müssen das zusätzlich erledigen. Weil die Zeit dafür nicht reicht, machen wir das oft abends oder am Wochenende.“ Routine? Fehlanzeige. „Ein Tag ist einfach zu unberechenbar“, sagt sie.
Weikert arbeitet 33 Stunden pro Woche, offiziell 85 Prozent, faktisch deutlich mehr. Ihr Gehalt: 3.930 Euro brutto, 2.560 Euro netto. „Meine Arbeit ist nicht weniger wichtig: Wenn wir einen schlechten Job machen, haben sie später mehr Arbeit mit den Kindern“, sagt sie.
Dabei hat Weikert selbst einen akademischen Weg eingeschlagen: Nach dem Abitur studierte sie Erziehungswissenschaften – ein Studium, das sie gezielt auf die Arbeit mit Kindern vorbereitete. Schon währenddessen engagierte sie sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit und arbeitete in einer Kita, die sie nach ihrem Bachelorabschluss übernahm.
Nach der Geburt ihres Kindes zog sie um, begann in einer neuen Einrichtung – und übernahm bald die stellvertretende Leitung. „Die Möglichkeit, das Konzept der Einrichtung mitbestimmen zu können, hat mich gereizt“, sagt sie. Eigentlich habe sie in Teilzeit einsteigen wollen, „aber um die Stelle zu bekommen, musste ich mindestens 30 Wochenstunden arbeiten“. Die Realität sei dann weit über das hinausgegangen, was sie erwartet habe: „Aus der ruhigen Konzeptionsarbeit wurde nichts – wir haben wegen Personalausfällen in einer anderen Kita ausgeholfen.“
Eine alte Forderung – neu erhoben
Dass das Gehaltsgefälle zwischen schulischer und frühkindlicher Bildung als ungerecht empfunden wird – und immer wieder Thema in den Kita-Kollegien ist – belegt ein ähnliches Protokoll, das bereits im vergangenen Jahr im Spiegel erschienen ist. Dort berichtete eine Erzieherin von ihrem Gehalt und ihren Ansprüchen an gerechte Bezahlung.
Die 33-Jährige, die zuvor in einem anderen Beruf tätig war, arbeitet heute Vollzeit im Kindergarten und verdient 43.012 Euro brutto im Jahr. „Mein Bruttomonatsgehalt liegt bei 3.463 Euro“, sagte sie dem Spiegel. Zusätzlich erhalte sie eine Benefit-Karte, auf die monatlich 50 Euro geladen würden, sowie ein Deutschlandticket und einmal jährlich eine steuerfreie Sonderzahlung von 950 Euro plus 500 Euro Urlaubsgeld.
Von ihrem Einkommen könne sie „gut leben“, sagte sie – aber sie wisse, dass das mit Familie schnell anders aussehen würde. „Hätte ich drei Kinder, sähe das anders aus. Mein Einkommen wird daher sicher auch meine Familienplanung beeinflussen.“ Vor allem aber empfinde sie die Bezahlung im Vergleich zu anderen Bildungsberufen als ungerecht: „Fair wäre, wie Lehrer bezahlt zu werden. Schließlich haben wir denselben Bildungsauftrag – da sollte es keinen Unterschied geben.“
Und weiter: „Menschen in Vorstandspositionen übernehmen sicher wichtige Aufgaben, aber ihre Arbeit ist nicht relevanter als frühkindliche Bildung. Ohne die würde schließlich das ganze System ins Wanken geraten.“
Wie belastend die Arbeit in den Kitas ist, zeigt aktuell eine Untersuchung des Instituts Arbeit und Wirtschaft (iaw) im Auftrag der Bremer Bildungsbehörde und der Arbeitnehmerkammer (News4teachers berichtete). Die Forscherinnen und Forscher befragten Kita-Beschäftigte zu Arbeitszufriedenheit, Belastung und beruflichen Perspektiven.
Das Ergebnis fällt deutlich aus: Rund 58 Prozent der Beschäftigten in Bremer Kitas arbeiten in Teilzeit, meist zwischen 30 und 35 Stunden pro Woche. 40 Prozent dieser Teilzeitkräfte wären grundsätzlich bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen – aber nur, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbesserten. Etwa ein Drittel der Fachkräfte plant in den kommenden Jahren eine Stundenreduzierung oder den Berufsausstieg. Besonders betroffen sind jüngere Beschäftigte und solche mit gesundheitlichen Problemen.
Als Hauptgründe nennen die Befragten die hohe Arbeitsbelastung, fehlende Vertretungsregelungen, mangelnden Gesundheitsschutz und zu große Gruppen. Auch das Arbeitsklima und ungelöste Konflikte im Team werden häufig genannt. Schon in der Ausbildung zeigten sich Probleme: Geringe Vergütung, unzureichende Verzahnung von Theorie und Praxis und fehlende Unterstützung im Umgang mit Konflikten führten dazu, dass viele den Beruf nicht dauerhaft ausüben wollen. Das Fazit der Forschenden: Ohne strukturelle Verbesserungen droht der frühkindlichen Bildung eine Erosion – in Qualität und Personalbestand.
Akademisierung als Schlüssel – und Herausforderung
Vor diesem Hintergrund fordern Fachleute seit Jahren, den Beruf der frühkindlichen Pädagogik strukturell aufzuwerten – nicht nur finanziell, sondern auch in seiner Ausbildung. Professorin Frauke Mingerzahn und Professor Jörn Borke von der Hochschule Magdeburg-Stendal sehen in der Akademisierung der Kindheitspädagogik einen zentralen Hebel, wie sie bereits 2021 in einem Interview für das Kita-Handbuch erklärten.
„Etwa seit Beginn der 2000er-Jahre lassen sich zwei Tendenzen beobachten“, sagt Mingerzahn. „Zum einen eine Professionalisierung – sichtbar in den Hochschulstudiengängen und in überarbeiteten Fachschulcurricula –, zum anderen aber Deprofessionalisierung durch den Fachkräftemangel und den massiven Ausbau der Kitas.“
Die Zahlen sprechen für sich: Zwischen 2004 und 2017 stieg die Zahl der Bachelorstudiengänge im Bereich Frühpädagogik von drei auf 72, dazu kommen 13 Masterstudiengänge. Mit ihnen, so Mingerzahn und Borke, komme „stärker wissenschaftlich ausgebildetes Personal“ in die Einrichtungen – Menschen, die Bildungsprozesse reflektierter begleiten und konzeptionell mitgestalten könnten.
Akademikerinnen und Akademiker brächten „vertieftes Fachwissen, eine andere Sprache und eine wissensbasierte Begründung ihres Handelns“ mit. Dadurch verändere sich auch der Habitus in den Teams. Mingerzahn betont: „Mit ihrer stärker wissenschaftlich basierten Urteils- und Reflexionsfähigkeit tragen Kindheitspädagoginnen zu einer weiteren Professionalisierung der Teams bei.“
Doch das birgt Spannungen. In der Praxis gebe es immer wieder Vorurteile: „Praktikerinnen sagen, Akademikerinnen könnten keine Gruppen führen, Studierende halten sich für besser ausgebildet.“ Diese gegenseitigen Zuschreibungen seien hinderlich. „Nur wenn Träger und Leitungen die Unterschiede produktiv gestalten, kann die Heterogenität im Team zur Stärke werden“, sagt Borke.
Akademiker*innen in der Kita – und trotzdem schlecht bezahlt
Hinzu kommt ein Widerspruch: Wer ein Studium der Kindheitspädagogik absolviert, verdient meist nicht mehr als klassische Erzieherinnen und Erzieher. „Träger haben durch berufsbegleitende Studiengänge die Chance, gut ausgebildetes Personal an sich zu binden – wenn sie die Studierenden unterstützen und nach dem Studium eine professionelle und finanzielle Weiterentwicklung ermöglichen“, erklärt Mingerzahn.
Genau das geschehe jedoch selten. Und so verlassen viele akademisch qualifizierte Fachkräfte den frühkindlichen Bereich wieder – in Richtung Hochschule, Verwaltung oder Familienbildung. Die Akademisierung sei eine große Chance, so Borke. Aber sie werde nur dann wirken, wenn sie mit echter Aufwertung verbunden ist. News4teachers









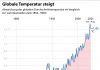
Warum verdienen nicht einfach alle das Gleiche? Einheitslohn!!! Dann sind alle zufrieden. Ausbildung und Qualifikation? Egal.
Dann würd ich mir mal zeitweise so nen richtig stumpfsinnigen Job suchen, ohne jegliche Verantwortung und sofort raus aus der Schule. Das wär was. Nach 1-2 Jahren würde ich mir dann wieder was neues suchen, hocharbeiten geht ja dann nicht mehr zumindest nicht vom Gehalt her.
Naja, da die genannten Beispiele studiert haben, bedarf es Ihrer Übertreibung nicht, angemessenen Lohn zu fordern.
Wenn jetzt noch jemand mit “in der freien Wirtschaft” aus dem Busch gesprungen kommt, sollten studierte Erzieher:innen viellicht sogar mehr verdienen, als verhältnismäßig überrepräsentierte Gymnasiallehrkräfte? 😛
Das Beispiel “aber in der Wirtschaft” kam ja direkt im Text – von einer der Erzieherinnen. Muss man ihr dafür jetzt Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld oder beides aberkennen in der etwas wirr aufgeworfenen Logik?
Habe auch studiert.
Arbeite an einer Privatschule.
Verdiene weniger als “Weikert”.
Und jetzt?
Sind eben so Schattenseiten, wenn man nicht den Packt der Verbeamtung und “Regelschule” eingeht – oft.
Ist eben auch ein anderes Profil im weiteren Sinne.
Ich hatte mich vor einigen Jahren mal erkundigt wegen Kita/ErzieherInnen.
Dort wurde mir mitgeteilt, dass zwar Bedarf da wäre, ich allerdings eben auch die Qualifikation nachholen müsste – also Ausbildung oder zweites Studium (Richtung Soz.-Päd.).
Als “Hilfskraft” (oder wie sie das nannten) würden sie mich aber (mit Kusshand) nehmen.
Die naheliegende Kita hätte mich allerdings sofort genommen, laut Anfrage. Auch als Erzieher. Nur der Staat/Anrechnung spielte eben nicht so mit.
Daher: Wie wäre es mit “Wechsel LuL/ErzieherInnen”. Gleiches Gehalt/Lohn?
Wäre da durchaus etwas interessiert ggf.
Kann sich ja dann jeder und jede aussuchen. Scheint ja egal zu sein?
“Sind eben so Schattenseiten, wenn man nicht den Packt der Verbeamtung und “Regelschule” eingeht – oft.”
Zustimmung! Einerseits bin ich der Meinung, dass Beamt*innen besonders für Abordnungen etc. herangezogen werden sollten (mich eingeschlossen), andererseits braucht es dringend mehr Lehrkräfte.
Andererseits ist, wenn alles gleich bleibt – wie immer 😛 – der Lehrkräftemangel ja in 20 Jahren vorbei und in Milliarden Jahren explodiert die Sonne, warum überhaupt noch wen einstellen…
Meinen Sie mich bezüglich der Frage nach Wechsel?
Kann nicht singen – daher eigentlich auch keine Primarstufe
Es gilt das Abstandsgebot.
Derzeit beläuft sich der Reallohnverlust für Lehrer bei ca. 16-18 %
Damit verdienen aktuelle Lehrer schon viel weniger als frühere in den 90ern oder 2000ern.
Es fehlt ein richtiges Weihnachtsgeld, ein 13. Monatsgehalt und eine Prämie.
Woanders kommen da nochmal 5-10k pro Jahr extra drauf.
bei diesen Arbeitsbedingungen, 41h Woche, kein Homeoffice usw. keine 4-Tage Woche nicht mehr tragbar.
Deshalb:
4-Tage Woche
30 % Homeschoolinganteil
Gehälter um 17 % rauf
DB & GK online!
Wieso? Wir haben doch Homeoffice mit komplett freier Zeiteinteilung zu einem erheblichen Teil.
ach wat Küsti, wir haben 5 Tage in der Schule in engen, kalten Räumen.
Teilweise bis 17 Uhr und abends noch Korrektur zuhaus.
2-3 Tage Homeoffice wäre wünschenswert 🙂
Abends und am Wochenende zu arbeiten ist …. Home-Office
Hmmm, ich bin heute Abend bis 21 Uhr in der Schule. Was mache ich falsch?
das hat Realist bereits alles widerlegt.
Oder wir senken die Deputate um 1/3!
führt auch zur 4-Tage Woche und Homeoffice
Wir Lehrer verdienen schon viel zu wenig und es wird schön gerechnet.
Extrazahlungen werden in anderen Branchen nicht ins Jahreseinkommen gerechnet!!!
Ich brauche die 4 Tage Woche und mehr online Unterricht.
Eure Peti
Liebe Petra,
du hast völlig Recht 🙂
Allerliebste Grüße von uns an Dich
und nach Lippe / so weit weg
Lehrer sollten die Inflation ausgeglichen bekommen, liebe Petra.
Du bist großartig
Online-Unterricht schadet nachweislich den Schülern. Wer das ernsthaft fordert, sollte den Job wechseln.
Quatsch Küsti, die Arbeitsbedingungen sind nachweislich schlecht.
Entlastung muss her und da ist die 4 Tage Woche und etwas Homeoffice kein schlechtes Ding 🙂
Wenn Lehrer nicht mehr Urlaub haben als “normale” Angestellte (also in den Ferien arbeiten) dann haben Lehrer mit den Schulferien schon aufs Jahr gerechnet fast einen Homeofficetag pro Woche.
Das mag sich anders anfühlen, ist aber so.
Zum Vergleich, beide haben 52 Wochenenden und 28 Urlaubstage.
Lehrkräfte haben 65 unterrichtsfreie Tage plus 5 Feiertage außerhalb der Ferien., also 70 freie Arbeitstage. In der freien Wirtschaft kommen zu den 28 Urlaubstagen noch 11 Feiertage.
Die Lehrkräfte haben somit 30 unterrichts freie Tage mehr.
222 Arbeitstage a 8 Stunden in der Wirtschaft zu 219 Unterrichtstagen a 8,11 Stunden in der Schule ergeben die gleiche Arbeitszeit. 0,11 Stunden sind 33 Minuten mehr je Woche. Die drei verpflichtenden Vorbereitungstage am Schuljahresanfang habe ich bei der Berechnung außer Acht gelassen.
Und dazu:
Erkrankung während der Ferien führt nicht zum Nachholen des “Urlaubsanspruchs” während der Unterrichtszeit.
Fortbildungen müssen in den Ferien abgeleistet werden, Bildungsurlaub während der Unterrichtszeit gibt es nicht.
IG Metall schlägt jeden Lehrerjob in Bezug auf die Arbeitszeit um Längen. Und jeder hat Verständnis, wenn der Staat die Unternehmen wegen hoher Energiekosten, fehlender Computerchips, falscher Produktpolitik oder Management-Versagen mit Sozialhilfe (= Subventionen) aufpäppelt.
Würden Sie Schüler, die in den Schulferien krank sind, die Ferientage auch nachholen lassen in der Schulzeit?
Haben SuS einen gesetzlich geregelten Urlaubsanspruch? Zählt der Schulbesuch von SuS zur Erwerbsarbeit?
Realist beklagt sich ja über seinen eigene gesetzlich geregelten Urlaubsanspruch, dann kann man auch auf die Schüler übertragen.
Ganz grundsätzlich sind Lehrer Arbeitnehmer und haben keine Ferien, denn sie haben unterrichtsfreie Zeit. In dieser unterrichtsfreien Zeit müssen Lehrer ihren Erholungsurlaub nehmen, müssen aber auch zu gewissen Zeiten der Schule zur Verfügung stehen. Erkrankt man während der unterrichtsfreien Zeit, kann der Erholungsurlaub nicht nachgeholt werden.
Schüler hingegen, sind keine Arbeitsnehmer und haben Ferien. Dies ist vom Schulgesetz her schon deutlich zu unterscheiden. Erkranken Schüler während der Ferien, ist dies irrelevant.
Lehrer und Schüler sind auch nicht auf Augenhöhe was ihre Rechte und Pflichten die Schule betreffend angeht.
Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen?
Nö. Schüler gehen beim Schulbesuch keiner Erwerbsarbeit nach, so dass sie Anspruch auf Erholungsurlaub hätten. Ihr Vergleich passt nicht.
Da haben wir wohl deutliche Meinungsunterschiede. Für mich ist die Erholungsphase für die Kinder wichtiger als die eigene. Für Sie anscheinend nicht.
Da haben wir nicht nur Meinungsunterschiede. Ihnen fehlt offensichtlich Wissen über den Unterschied von Erwerbsarbeit und der kostenlosen Nutzung eines staatlichen Bildungsangebotes.
Und “kostenlose Nutzung eines staatlichen Bildungsangebotes” schafft die Notwendigkeit von Erholung ab?
Wann hätte Schüler denn ein legitimes Bedürfnis nach Erholungszeit? Nur wenn Schule kostet? Oder wenn sie nicht staatlich ist?
Beide Sachverhalte haben einfach nichts miteinander zu tun. Das Eine ist der gesetzlich vorgeschriebene Erholungsurlaub für Arbeitnehmer. Was Schulkinder betrifft, gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Wie Sie oder ich oder sonstwas das privat finden, ist da völlig unerheblich.
Also ich wär ja dafür, dass alle Eltern für die Zeit der Schulferien bezahlten Urlaub vom Arbeitgeber bekommen und alle Schüler in der Zeit der Ferien von den Lehrern an schönen Urlaubsorten betreut werden. Dann haben alle Seiten genügend Erholungszeit voneinander.
Äääh, …die Lehrer zwar nicht, aber who cares! 🙂
Wie war das nur noch mal in meiner Kindheit und Jugend? Meine Eltern arbeiteten beide Vollzeit … und ich habe meine Freizeit, trotz (fast täglicher HA, auch übers Wochenende und über die Ferien) ausgiebig zum Erholen, Bücher lesen, mit Freunden “Dummheiten” machen, Disco … ausgiebig genutzt. Komischerweise haben wir uns nach dem Unterricht , an den Wochenenden und in den Ferien von der Schule “erholt”. Im Sommer waren wir den ganzen Tag am Baggersee…Aber wahrscheinlich werde ich langsam senil und meine Erinnerung trügt mich. Diese verfälschten Erinnerungen scheinen bei vielen Boomern zu grassieren. Da muss dringend was dagegen getan werden. 🙂
Egal wie Sie es drehen und wenden, Lehrer und Schüler besuchen lediglich die gleiche Behörde, haben aber sehr unterschiedliche Rechten und Pflichten….vielleicht lesen Sie erstmal das Schulgesetz der verschiedenen Bundesländer, bevor Sie hier irgendeinen Unsinn erzählen….
“vielleicht lesen Sie erstmal das Schulgesetz”
Warum schreiben Sie das nicht an “Realist”, der sich ja über die geltende Rechtslage beklagt hat und auf dessen Klage ich reagiert habe?
Atmen Sie erleichtert auf: Von mir aus soll jeder Schüler so viel und so lange “Urlaub” bekommen, wie er/sie will.
Das würde mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Von daher: Bin ganz bei Ihnen, meeeeeeeaaaaar Urlaub für Schüler!
Gehen wirs mal durch:
In Bayern hat das Schuljahr 25/26 genau 183 Schultage (ich hoffe, ich hab mich nicht verzählt). Dazu kommen Buß- und Bettag sowie die Anfangskonferenz. Macht also 185 Tage, der Rest der Arbeitszeit liegt in den Schulferien und ist damit potentiell homeofficegeeignet. Ein Arbeitnehmer hat (nach Ihrer Rechnung) 365-104-28-11 Arbeitstage, also 222 Tage.
Macht 37 Tage Differenz, bei 38 Schulwochen. Also quasi für jede Schulwoche einen homeofficegeeigneten Tag.
Das mag Ihnen nicht reichen, aber das ändert nichts daran, dass es schon jetzt einiges an Homeoffice gibt.
184 Schultage, das ist ein halbes Jahr. Die 13 Wochen unterrichtfreier Zeit sind ein Vierteljahr. Die Differenz macht stutzig.
Die Wochenenden sind 104 Tage, das sind 28,5% der Tage im Jahr, passt also wieder.
Aber Sie müssen mir nicht glauben, zählen Sie einfach selber die Schultage, die Termine sind ja bekannt.
Für das Schuljahr 23/24 und 24/25 und habe genau 191 Tage plus 3 Vorbereitungstage für NRW gezählt. 39 Wochen a 5 Unterrichtstage minus 5 Feiertage. Die 28 Urlaubstage, die sich mit den Ferienterminen überschneiden müssen an einer Stelle berücksichtigt werden, die sind definitiv arbeitsfrei.
6,5 Wochen Sommerferien sind 33 unterrichtsfreie Wochentage ohne Samstage und Sonntage. Davon sind 28 Tage Urlaubsanspruch und 3 Vorbereitungstage anzuziehen.
Von den 65 feiertagsbereinigten Ferientagen bleiben unter Berücksichtigung des Urlaubsanspruches am Ende nur 37 Tage übrig, an denen Lehrkräfte im direkten Vergleich zu anderen AN keine Unterrichtsverpflichtung haben. Ein Teil dieser Tage wird je nach Fakulten aber mit Korrekturen verbracht. In den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien gehen jeweils mindestens zwei Tage für Korrekturen drauf.
Es wird Zeit, dass die AZE für Lehrkräfte umgesetzt wird, da sich nur so die tatsächlichen Arbeitszeiten nachweisen lassen. Für eine aussagekräftige, valide Kennzahl würde ich dann den Meridianwert aller erfassten Datensätze von Vollzeitkräften heranziehen, um eine Aussage über die zeitliche Arbeitsbelastung von Lehrkräften zu machen.
Ich hab das für Bayern gezählt, da sind es anscheinend weniger Unterrichtstage.
Aber vielleicht ist nicht ganz klar geworden, dass ich mich nicht zu unserer Arbeitsbelastung geäußert hab, sondern über die Homeofficemöglichkeit.
Dass das ein Unterschied ist, scheint einigen “Realisten” hier nicht ganz klar zu sein.
Wie kommen Sie darauf, das unterrichtsfreie Zeit = arbeitsfreie Tage sind?
Realist hats uns vorgerechnet. In den Ferien liegen viele Feiertage.
Manche arbeiten pro Woche 50h.
Lehrer benötigen dringend die 4 Tage Woche und mehr Homeoffice.
Warum verdiene ich so viel weniger als meine verbeamteten Kollegen, warum verdiene ich so viel weniger als ein W3-Professor…
Warum sind ErzieherInnen und Lehrkräfte gleichermaßen überlastet und gestresst von ihrem Wunschberuf, lassen sich aber immer wieder gerne in solche Diskussionen treiben? Divide et impera?
Warum sind Sie nicht verbeamtet?
Trägt das zum Thema bei? Oder ist das eine Frage wie ‘ja, aber woher kommen ihre Eltern wirklich’? Wenn’s denn der Wahrheitsfindung dient: 1. Examen als es zu viele gab, dann ‘ein Leben’, 2. Examen als gesucht wurde und irgendwann gibt es so etwas wie eine Altersgrenze.
Oder steckt hinter der Frage die Annahme ‘war zu schlecht für Verbeamtung’ oder ‘ist sicher nur (?) Quereinsteiger’? Sorry, komplett identische Ausbildung, exakt gleiche Tätigkeit.
Ernstgemeinte Frage:
Nimmt man da nicht aus purem Hass darüber, dermassen abgezockt zu werden die “nächste Abfahrt” ?
Und vorher “mit was geht” ?
Bin in derselben Situation, habe aber an einer Bekenntnisschule gearbeitet (freier Träger). Nach dem Wechsel in den Staatsdienst dann zu alt für die Verbeamtung.
Nee, kein Hass, nur Frustration ob dieser Tatsache. Und Angenervtsein, wenn die beamteten Kollegen ihre Vorteile gegenüber ihren angestellten Kollegen kleinreden anstatt anzuerkennen, dass sie diesen gegenüber privilegiert sind.
Meinen Job mag ich ungeachtet dessen und mache ihn gut. Was soll ich da „mitnehmen, was geht“? Blaumachen? Nee, nicht mein Berufsethos.
Dito, ich mache es gerne und ganz oder gar nicht, aber diese Frustration ist schon da. Auch KuK, die tatsächlich nichts über unterschiedliche ‘Ruhestandsbezüge’ oder Regelungen bei längerer Krankheit wissen, bringen mich immer wieder zum Kopfschütteln. Der Gedanke, bei zunehmendem Chaos und immer mehr Zumutungen einfach mit einigen Monaten Kündigungsfrist gehen zu können ist manchmal ganz hilfreich.
Es tut gut, so etwas zu lesen. Ich habe sehr gern als Springerin gearbeitet und mehr Freiheit war mir wichtiger als mehr Geld.
Häufigste Gründe: Alter oder Amtsarzt
Weil niemand Spaß versteht, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht.
Dass die Erzieherin das nicht versteht liegt vermutlich daran, dass sie den Lehrerberuf fatal unterschätzt.
Oder ist es so, dass die Grundschullehrkraft fatal den Beruf des Oberstufenlehrers unterschätzt? Sie verstehen 🙂
Oder ist das so, dass die
Gymnasial l e h r k r a f t! fatal den Beruf der Grundschullehrer unterschätzt? Sie verstehen
Das Wort Lehrer! macht hier den Unterschied.
Dass Sie als Lehrer das nicht verstehen, liegt vermutlich daran, dass sie den Erzieherberuf fatal unterschätzen.
Ist schon krass, wie sich die stumpfe Hoffnung, dass sich Erzieher:innen dies weiterhin geben, aufrecht erhält. Bei den Studierten wird es offensichtlich!
Während meine Mitbewohnerinnen noch als “FELBI” studierten, wurde diese Berufung als Restera… “Quereinstiegsmöglichkeit” behandelt (https://www.tagesspiegel.de/politik/erziehen-statt-kassieren-6687118.html)
IRGENDWAS mit Kindern halt 🙁
Aber sowas geht ja heute nicht mehr…. nicht wahr? ….
Wegen mir könnte man die Kita-Menschen genauso bezahlen wie die Grundschullehrer. Nur müsste dann die Ausbildung vergleichbar werden.
Vor allem müssten die realen Ansprüche an den Beruf mal verglichen werden.
– Dann macht die Kita halt nicht mehr zu, wenn jemand fehlt
– Dann wird mal festgelegt, welche Bildungsziele Kitas haben
– Und diese kräftig eingefordert und nicht mit wenig Personal vom Tisch gewischt
– Dann gibt’s halt regelmäßig Angebote, auch wenns zusätzlich vorbereitet werden muss
– etc., etc., etc.
In der Regel kommen Erzieher, Pädagogen (welche auch immer), Sozialarbeiter mit den Problemlagen, weswegen Lehrer gerne “Burnout” schreien, besser klar.
Liegt eben an der Aus ildung, die Sie als nicht vergleichbar bezeichnen.
Oh oh, das lag noch ganz unten in der Klischeekiste rum und musste raus.
Ja, musste es. Was unten in der Klischeekiste liegt, kann man hier täglich hundertfach in Lehrerkommentaren lesen.
Ist das so? Da haben Sie doch sicher wissenschaftlich belastbare Belege für? Gern hier verlinken!
Als Lehrer verstehe ich mich durchaus als “Pädagoge”, wie auch immer.
Sehe ich anders. Man muss nicht jeden Beruf akademisieren, nur um immer höhere Gehälter zu fordern. Kann man bald Gebäudereinigung studieren, damit Putzkräfte mit 5000 Euro nach Hause gehen?
Angebot und Nachfrage, “money walks the walk, bull**** talks the talk”:
Es ist wie beim “Fachkräftemangel” – wären Putzkräfte wirklich unersetzlich (also, in echt, der ungefilterten Realität, NICHT in “vorschriftenecht”) würden die auch 5 K bekommen.
Bei uns Lehrkräften ist es nicht anders.
Oder überhaupt bei keinem Beruf.
Meinen Sie nicht, die Ausbildung an Erzieherfachschulen und nicht minder im Grundschullehramt müsste gleichermaßen erheblich verbessert werden? Stichwort: Rechtschreibung. (Das fällt vor allem den Großeltern unangenehm auf…)
Wir können den grauen Wölfen dankbar sein, dass der peinliche “Schweigefuchs” als Geste endlich aus Kitas und Grundschulen verschwunden ist oder nur noch als peinlicher Ausrutscher vorkommt. Nicht ausgeblendet werden sollten, dass es in Kita und Grundschulen zu tragischen und vermeidbaren Ertrunkungsunfällen gekommen ist. Hätten Menschen mit Praxiserfahrung ihr Wissen über eine vernünftige Ausübung der Aufsichtspflicht weitergegeben, würde manches Kind noch leben.
(Früher hieß es im Refrendariat noch: Mit Grundschülern geht ihr grundsätzlich nicht in ein öffentliches Schwimmbad.)
„Hätten Menschen mit Praxiserfahrung ihr Wissen über eine vernünftige Ausübung der Aufsichtspflicht weitergegeben, würde manches Kind noch leben.“
Das dürfte man dann auch direkt auf die Ausbildung der SEK I und SekII Lehrer ausweiten. Dann würde dort so mancher Teenager (Stichwort Aufsichtspflicht bei Klassenfahrten, sexuelle Übergriffe) noch unbeschadet sein…..
Danke. Ich habe ganz überwiegend jüngere Kinder betreut, stimme Ihnen aber zu. Schon früh muss man bei Schulkindern realisieren, welche Gefahren ihnen drohen, wenn sie sich beispielsweise auf Internetkontakte einlassen, sich erpressen lassen und am Ende sogar körperlichen Missbrauch erleben. – Eine Vertrauensbasis ist immer wichtig!
Da hat Schule in der Regel nichts mit zu tun.
Sie sprachen über Aufsichtspflicht….
Dass jemand mit einem Studium der Kindheitspädagogik mehr verdienen sollte als ein normaler Erzieher, halte ich für stimmig. Dass allgemein Erzieher zu wenig erhalten, gerade mit Blick auf die doch sehr lange Ausbildung, halte ich auch für richtig.
Aber meiner Einschätzung nach sind Lehrer einfach die falsche Bezugsgröße für Erzieher. Ja, wir haben alle mit Kindern zu tun – aber das hat der Schulbusfahrer auch.
Die meisten Pädagogikstudent*innen (Kindheits- u.a.), die bei uns zu Praktika antreten, haben viel theoretisches Wissen angehäuft, können aber kaum mit 10 Kindern ein Kreisspiel organisieren oder eine Bastelaktivität.
Will sagen: Nicht der Abschluss, sondern die Praxistauglichkeit der Ausbildung ist entscheidend.
Das ist infam bezüglich der Qualifikation! Was Sie da schreiben ist bashing…..
Unsere PMs (ausgebildete Erzieherinnen) halten den ganzen Wahnsinn des Nachmittags aus und können ganz vielen tolle Sachen….gerne auch mit 35 Kindern….
Die Studenten haben ja auch noch kein Referendariat gemacht. Sie sind noch voll auf die Theorie konzentriert. Ihr Vergleich hinkt völlig!
Es gibt gute und schlechte, genau wie bei den Lehrern.
Meine Erfahrung: Die “meisten” Pädagogikstudenten können das.
Dann sind die Schulbusfahrer bestimmt die nächsten, die A oder eben E13 für alle verlangen. Es ist abzusehen.
Welcher Busfahrer ist beim Land angestellt oder verbeamtet? Genau keiner!
Bei den bereitschaftspolizeien gibt es Busfahrer, ob die tarifbeschäftigt oder verbeamtet sind, weiß ich allerdings nicht.
Nö. Die Linien- und auch Schulbusfahrer möchten mittlerweile lieber einen Arbeit haben, bei der sie nicht andauernd zum Einspringen bei Personalausfall aufgefordert werden. Reisebusse bieten den Vorteil, dass sie Toiletten haben, in Urlaubsregionen führen und sogar finanziell attraktiver sind.
Die Busfahrer gehen vielleicht sogar davon aus, dass die Lehrer wirklich viel zu wenig verdienen. – Beim Trinkgeld sollen andere erheblich freigiebiger sein.
Ich kannte einmal einen Reisebusfahrer. Der müsste/durfte in den Fahrpausen Kaffee und Würstchen verkaufen…für die eigene Tasche.
Der wusste immer gar nicht wohin mit dem (Klein-) Geld.
Er lieferte was bestellt wurde – und profitierte, da er Realität richtig deutete. Ein Vorbild.
Das Busfahrerbeispiel ist passender als gedacht:
In unserer Stadt finden sich (fast) keine mehr – großes Geheule, warum keiner mehr will kann sich der geneigte Leser denken (sollte es jedoch nicht sagen).
Es folg(t)en:
1. Jahrelange “Krisensitzungen” im Stadtrat – mit Schnittchengarantie. (Ich bürge für die Frische der Metzgerschnittchen)
2. Regelmässige Artikel in diversen Lokalblättchen.
3. Ganz allgemein großes “Händeringen” in der (Quassel-, ähhhh) Zivilgesellschaft.
Nur EINE Sache, die steht völlig ausser Frage:
Nettolohn mal richtig rauf? Aber naaaaaaiiiiiiiin !
Führerscheine sponsorn? Aber Doppel-Naaaaiiiiin !
Wenigstens sowas halbwegs kostenneutrales wie “Trainee”-Support,also angehende Busfahrer auf “Privatgelände” der Stadt mal probefahren lassen o.ä., was ja ginge ?
Auch nöööhhhh.
Die ungeschminkte Wahrheit ist also:
In ECHT (der ungefilterten Realität) ist der Mangel an Busfahrern für Öffis bei uns egal.
Das Beispiel mit den Busfahrern habe ich natütlich nicht grundlos gewählt. So wie Hausmeister früher ihr Gehalt durch die Einnahmen aus einem kleinen Kiosk aufbessern konnten, verkaufen schon seit vielen Jahren Fahrer von Reisebussen, was die Gäste schätzen. (Das kann die Laune heben – und manche erfreuen ihre Fahrgäste dann auch noch mit Gesang, Witzen oder ihren Kenntnissen als Reiseführer.)
Wann gibt es endlich mal Befragungen, die darauf abzielen, wer denn unserere Ansicht in seinem (TRaum)Beruf viel zu gut im Vergleich zu anderen Menschen für seine Arbeitsleistungen bezahlt wird?
Ich wünsche mir, dass Menschen, die in der Altenpflege und in der Krankenpflege eine gute Arbeit leisten – in jedem Beruf gibt es “solche und solche” – dafür besser entlohnt werden als Kitafachkräfte, wenn sie eine solide, gute Arbeit erbringen. Unsere Gehälter sind stärker angezogen als die in vielen anderen Berufen, weil der Kitaplatzausbau nach Devise “Masse vor Klasse” durchgezogen wurde. Und weiterhin lässt mal “Fachkräfte” in Kitas arbeiten, die man früher nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen hätte. Zur Erinnerung “Seelenprügel” von Anke Ballmann: https://www.penguin.de/content/edition/excerpts_extended/Leseprobe_978-3-328-10894-8.pdf
Passen Sie gut auf, dass Ihnen bloß niemand was wegnimmt. Die Angst ist groß, oder?
Wenn Sie nicht merken, was Ihnen ständig (und in ständig eskalierender Schnelligkeit) weg genommen wird – dann sind Sie noch viel wirtschaftlich ungebildeter als ein amateurhafter Autodidakt wie ich. Und wenn es mal nur Geld wäre…
Wie weit hat sie denn studiert? Bachelor oder Master? Wenn man ihr Netto-Gehalt mit einem A13 Beamten vergleicht, der in der GKV versichert ist, und berücksichtigt, dass sie Teilzeit arbeitet und eben nicht 41 Wochenstunden, ist ihr Gehalt gar nicht so gering.
Vor 12 Jahren bin ich als frisch gebackener A13 Studienrat in Vollzeit mit GKV mit 1.980€ netto nach Hause gegangen.
In manchen Bundesländern werden Grundschullehrkräfte nach E12 / A12 vergütet.
Und manchmal ist E12/A12 in dem einen Bundesland fast gleich wie E13/A13 in dem anderen. Merkst was?
Man merkt, dass die Wertschätzung in manchen Bundesländern durchaus höher ist….
… oder die Lebenshaltungskosten …
Wirklich?Sind die wirklich zu unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland?
Wenn A12 in manchen Bundesländern gleich hoch ist wie A13, wo genau sehen Sie da eine Wertschätzung?
Die Grunerwerbssteuersätze sind auch nicht in allen BL gleich hoch. Der Wettbewerb zwischen den BL war doch gewollt zu Zeiten der neoliberalen, geistig moralischen Wende.
Und wo genau ist das? Nennen Sie doch mal ein Beispiel….
Ja, in BaWü bedeutete A12 lange Zeit so viel Gehalt wie A13 in MV. Hat sich wohl erst jüngst geändert.
Wie hoch wären denn die Unterschiede bei E12 nach TVdL zwischen BW und MVP?
Dann gehen Sie mal nach RLP. Bezahlen Beamte niedrig und A12 für Grundschullehrer.
Klar merke ich was. Berichten Sie doch mal wie hoch die Unterschiede bei E12 nach TVdL zwischen den Bundesländern sein sollen.
Im Artikel steht, dass sie nach dem Bachelor-Abschluss übernommen worden ist. Die Eingruppierung müsste im Eingangsamt zu S11 gem. TVöD SuE erfolgen.
Nö, es geht nicht nach Ausbildung sondern Stelle. Ist wohl eher im Bereich der Entgeltgruppe 9.
Bei Kitas kommt es bei der Eingruppierung der Leitungsfunktionen auch auf die Größe der Einrichtung an, je nach Tarifvertrag.
Nicht als stv. Leitung lt. Text.
Wenn man das im ersten Fall (Studium mit Abschluss Bachelor) Gehalt von 3930€ für 33h mal auf eine volle Stelle hochrechnet, wären das 4763€.
Mit Abschluss Bachelor wird man in der Regel auch als Lehrer höchstens mit E11 eingestellt: das Einstiegsgehalt beträgt hier 4065€, nach mindestens drei Jahren ist man dann bei 4620€ und erst nach mindestens 6 Jahren bei 5069€, alles ohne Zuschläge.
Ich verstehe nicht ganz, was die Kollegin mit „so viel weniger als ein Lehrer“ meint – ich sehe da keine große Differenz.
Ein Bachelorabschluss ist nun mal nicht mit Master+2. Staatsexamen vergleichbar. Der eine dauert i.d.R. 3 Jahre, der andere 6-7 Jahre. Logischerweise schlägt sich das im Gehalt nieder.
PS: wenn ich mit 2. Staatsexamen als Lehrer in einem Ausbildungsberuf (Kita-Erzieher) arbeite, erhalte ich ebenfalls kein Lehrergehalt. Es kommt halt auch stets drauf an, wo ich mich bewerbe!
E11 erhielten in NRW alle nicht-grundständigen Lehrkräfte mit abgeschlossenem zweitem Staatsexamen, die keine Lehrbefähigung für die SekI+II haben.
Sie verdient mit einem Bachelorabschluss bei 33 Stunden 3900 € netto. Auf Vollzeit hochgerechnet sind das knapp 4900 €. A12 (das in manchen Ländern noch gezahlt wird) steigt mit etwa 4400 € ein – und das mit einem Masterabschluss. Sooo schlecht bezahlt finde ich das im Vergleich jetzt gar nicht. Zumal es in KiTas tatsächlich eine Arbeitszeiterfassung gibt und nicht massenweise unerfasste Überstunden.
BRUTTO!!! Gott noch eins!
Dann eben 3900 brutto in Teilzeit und 4900 brutto bei Vollzeit. Ändert aber nichts daran, dass es in Vollzeit mit Bachelor mehr wäre als bei einem A12er mit Masterabschluss.
Nur dass der A12er keiner Sozialversicherungspflicht unterliegt.
Ist der gleiche Grund warum ein A12er einen E12er für überbezahlt hält, da E12 brutto höher ist als A12 bei gleichen ELSTAM.
Ist dann aber netto doch deutlich weniger. Weniger als beim angestellten Lehrer und noch mal deutlich weniger als beim verbeamteten Lehrer.
TVöD SuE vs TV-L.
Der TVöD ist zumal deutlich! besser als der TVL…
Vor allem der kommunal Tarif.
Als die Straßenmeistereien von den Landschaftsverbänden (Kommunalverbände) zu Straßen NRW als Landesbehörde wechselten, war das für die langjährigen Mitarbeiter eine Gehaltskürzung, die durch Ausgleichszahlungen kompensiert wurde.
Lange nicht alle Lehrer sind verbeamtet….und somit kommen sich die Gehölter schon sehr deutlich nah.
Wenn ich die Abzüge google, bliebe netto etwa gleich viel übrig. Beim Beamten gehen dann aber noch mal etwa 200 bis 300 € Krankenkasse ab.
Und Angestellte haben grundsätzlich keine privaten Zusatzversicherungen, weder bei Gesundheit, noch Pflege noch Rente. – Aber natürlich ist die Erde eine Scheibe:(
Komisch: meine verbeamteten Kollegen haben bei gleicher Dienstzeit, gleicher Steuerklasse, gleichem Familienstand und Kinderzahl nach Abzug der Krankenkasse rund 1000€ netto mehr im Portemonnaie als ich. Unterschied E13 zu A13…
Deshalb geht die Verbeamtung auf Lebenszeit ja auch mit dem “Gelübde der ewigen Armut” einher.
Süß. Bei den angestellten Lehrern geht mehr als das doppelte für die Krankenkasse ab (nur Arbeitnehmeranteil). Zum Ausgleich sind die Leistungen schlechter.
A 12 hat auch keine Leitungsfunktion. Es geht hier um eine stellvertretende LEITUNG!!! Von der Erfahrungsstufe wissen wir auch nichts. Die erste Erfahrungsstufe ist es mit Sicherheit nicht.
Brutto interessiert doch nicht – die Frage ist, was nachher zur freien Verfügung tatsächlich auf dem Konto bleibt.
Brutto haben wir in der BRD alle fantastilliardische Gehälter und sind “”””reich””””.
Ich habe als Lehrer nach 40 Jahren dieses Gehalt nicht! arbeite Vollzeit und nur angestellt
Das war zu erwarten (Titel), als es anfing, dass Grundschullehrer doch angeblich das Gleiche leisten wie Gymnasiallehrer und jeder auf seine Weise seine besonderen Herausforderungen hat und deshalb alle gleich verdienen sollen. Als das immer als Argument für A13 für alle vorgebracht wurde, dachte ich mir schon, bald werden auch die Erzieher sagen, es sei unfair, dass sie so viel weniger verdienen, weil die Unterschiede keine seien und die geringere Bezahlung eine Geringschätzung ihrer Arbeit gleichkäme. Nun ist es so weit. Warum ist es ok, wenn Erzieher so viel weniger verdienen?
Ich finde es schon seltsam, dass in NRW alle zukünftigen Schulleitungen im SLQ gemeinsam fortgebildet werden. Eigentlich müssten doch SekII Schulleiter viel qualifizierter, weil hochwertiger gebildet werden…..warum nicht? Weil der Job derselbe ist mit allen Höhen, Tiefen, mit denselben Kenntnissen und Anforderungen….und trotzdem verdient der Rektor zwei Gehaltsstufen unter dem Direktor…..obwohl es dieselben Aufgaben sind (nur der Rektor hat keine Koordinatoren und macht alles in einer Person) Ganz eigentlich müsste der Rektor deshalb mehr verdienen….tja
So lange es noch genug Leute freiwillig anstreben/machen… 🙁
😉
Es ging nie drum, dass man „das Gleiche leistet“, es ging darum, dass gleiche Abschlüsse auch gleich bezahlt werden müssen.
In den Diskussionen ging es meistens genau darum, dass man das Gleiche leistet. Was die einen mehr an Korrekturen hätten, hätten die anderen mehr an Erziehungsarbeit usw.
Ist doch auch so.
A13 für alle war wegen der gleichlangen und gleichwertigen Ausbildung geboten. Alle müssen einen Master machen. Wenn man nicht A13 für alle wollte, dann hätte man einfach die Grundschulausbildung so belassen müssen. Wollte man aber nicht. Dann muss man jetzt auch A13 für alle ertragen.
Ich hätte mich niemals über a12 beschwert, wenn ich dafür kürzer studiert hätte. Aber Master machen und A12? Sorry das ging nicht!!
“Aber Master machen und A12? Sorry das ging nicht!!”
Das ging jahrzehntelang.
Und es gab einen Lehrerüberhang!
Weil sie keine Lehrer sind und nicht studiert haben.
Der Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher entspricht laut DQR dem Bachelor-Degree.
Das gleiche gilt für Fachwirte oder staatl. gepr. .
Sie sind keine Lehrer und haben nicht an einer Universität studiert.
Für die vierjährige Ausbildung zur Erzieherin, brauchen Sie weder ein Abitur , ein Hochschulstudium noch zwei Staatsexamen . Die Unterschiede sind also nicht so ganz unerheblich .
Europäischer Referenzrahmen sach ich da nur.
Mülltonnendeckel auf, Europäischer Referenzrahmen rein, Realitätscheck machen!
Ich weiß nicht, ich weiß nicht … Die Erzieher*innen in unserer Grundschule rechnen jedes Elterngespräch auf dem Parkplatz als Arbeitszeit ab, Konferenzzeiten, Veranstaltungen etc. werden minutengenau abgebummelt und während der Ferien handhabt man gern kreative Arbeitszeitmodelle.
Während die Grundschullehrkräfte von Eltern 24/7 über alle Kanäle kontaktiert werden und Lebenshilfe leisten, sind Erzieher*innen nicht erreichbar und würden nach dem Verlassen des Arbeisplatzes keine Mail mehr beantworten. Für das Schreiben von Protokollen, Vorbereiten von Aktivitäten etc. gibt es separate Zeitfenster, der Pausenanspruch wird vehement durchgesetzt, es gibt nur eine geringe Dokumentationspflicht und keine ggü. den Eltern … es gibt schon deutliche Unterschiede zwischen beiden Berufen.
Die Gehaltsdiskussion höre ich mind. 1x/Woche. Wenn man dann sagt, dass der Weg zur Lehrkraft nicht offen ist, wirkten bisher alle dankend ab. Dafür muss es ja Gründe geben.
Ja, natürlich! Lehrer haben einen Monatssalär, PMs werden nach Stunden bezahlt….Sie möchten bestimmt nicht wie ein PM bezahlt werden….ganz sicher nicht!
Das kenne ich aber von den meisten Lehrerkollegen auch. Nach Unterrichtsschluss darf man sie nicht mehr kontaktieren. Nach seiner letzten Stunde bleibt kaum jemand freiwillig länger. Gespräche? Morgens vor dem Unterricht oder bitteschön in einer Pause, egal, wie die Arbeitszeit der Eltern ist Telefonnummern werden nicht herausgegeben. E-Mails verbittert man sich. Die Schüler sollen ihr Problem in der Schule selber lösen. Das wäre also ziemlich gleich. Von daher also doch eher gleicher Lohn für gleiche Arbeit???
Ja, das ist wie beim Arzt, da muss man die Termine auch nehmen, wie sie zugeteilt werden…..
Und ja, Eltern müssen sich für die Schule Ihrer Kinder auch mal freinehmen.
Schule ist eine Bildungsanstalt, eine Behörde. Wie jede andere Behörde auch, gibt es Regeln, wie man in Kontakt treten kann.
Und nein, Lehrer müssen nicht immer Gewehr-bei-Fuß stehen, sondern nur im Rahmen ihrer Arbeitszeit und ihrer Präsenzzeit in der Schule.
Ich hatte gestern eine sehr erhellende Fortbildung zum Thema Schulrecht. Gehalten von einem Richter eines Verwaltungsgericht in NRW.
Der war da sehr deutlich, dass Lehrer die einzigen Beschäftigten einer Behörde seien, die über ihre Rechte und Pflichten oft im Dunklen tappen und die sich auch noch dafür entschuldigen, wenn sie nicht alle an ihnen „oft völlig herangetragenen und oft „völlig überzogenen“ Bedarfe befriedigen können.
Er riet dazu, wenn wieder jemand kommt, der sagt „das müssen Sie aber“ oder „das dürfen Sie nicht“ sofort zu fragen, „wo steht das?“…..
Einen Vater, der mich mal abends um 21:30 Uhr angerufen hat, habe ich am nächsten Morgen um 6:00 Uhr zurück gerufen, weil er mich ganz dringend um Rückruf gebeten hatte.
Sowas hab ich auch schon gemacht …hahahaha! Die Reaktion war unbezahlbar!
Und einen Vater (!), der mitten im Unterricht stand und nur “kurz” was erörtern wollte, habe ich nach seinem Arbeitsplatz sowie seiner Arbeitszeit gefragt, weill ich dann dort auch mal “kurz vorbeikommen” möchte, um was zu erörtern… Auch da war die Reaktion unbezahlbar. Was hatte ich einen Spaß!
Tja, heute werden Eltern darauf hingewiesen, dass sie ihr Anliegen bitte per Email kommunizieren. Private Telefonnummern gibt wohl keiner mehr raus….hat auch was für sich…
Finde ich spannend. Wo gibt es diese Fortbildung?
Auf Ebene der Bezirksregierungen.
Auf Ebene der Stödte und Bezirke in ganz NRW
Als SL war sie verpflichtend….aber ich habe den Auftrag, mein Wissen weiterzugeben….
https://www.schulministerium.nrw/nachgefragt-der-msb-podcast-smartphones
https://www.buecher.de/artikel/buch/schulrecht-mal-anders/49475506/
Bitte schön….
Es geht darum, dass Fehlverhalten sanktioniert wird und das justiziabel. Es geht darum, dass Täter Konsequenzen spüren in einem pädagogischen System. Es geht um Rechte, die Lehrer haben (nein, niemand muss sich schlagen und beleidigen lassen). Vor allem geht es darum, Ordnungsmaßnahmen rechtlich wasserdicht zu machen.
Ministerin Feller will Gewalt an Schulen eindämmen und Schulen handlungsfähig machen. Es geht auch darum, die Täter- Opfer-Umkehr zu verhindern…..
Meine Lieblingsfrage. 🙂
Dann sind Sie den meisten LuL voraus….die meisten LuL fangen an zu argumentieren und sich zu rechtfertigen….nein, habe ich gelernt, das ist nicht richtig….
„Ich kann nicht“, „Nein weil….“…“Tut mir leid, aber….“….So geht es in einer Tour…..das ist falsch….
Also für mich hört sich das so an, als ob diese Erzieher alles richtig machen.
Wie unausrottbar hängt eigentlich in den Köpfen fest, dass Menschen in sozialen Berufen quasi wie mittelalterliche Mönche dem “deus” UNBEZAHLT ihr ganzes Leben widmen sollen?
Mensch, da jammer ich demnächst auch:
“Boah, diese sch*** Frisöre, nur mal gerade auf’m Parkplatz einfacher Männerhaarschnitt, MINUTENGENAU rechnen die das ab! Lol, geht ja garnicht!”
“Boah ey, diese KfZ-Mechatroniker, so eeeeekelig, nur mal gerade meine Reifen wechseln, ist doch für die ein Klacks! Sind ja nur fünf Minuten! Aber gleich wieder Geld verlangen!”
Liebe Leute in nicht-sozialen Berufen, hiermit übergebe ich euch die Forderungsliste für den Rundumservice, wo ich dann anfange “für/im Beruf” zu leben und entgrenzt 24/7 Sachen gratis zu machen:
– RESPEKT und GEHORSAM wie in Korea, Japan, Singapur
– rechtliche und nicht-rechtliche Autorität gegenüber amtsbezogenen Anweisungen meinerseits wie in den 1950ern
– zusammen mit dem Dorfpfarrer bin ich natürlich bei jeder pseudowichtigen Gemeindepolitiksache dabei und bin dabei ein real entscheidender Faktor
Bis dahin gilt:
– “Arbeitsvertrag” bzw. Beamtenrecht
– Geliefert wie bestellt
Na, den Lehrer möchte ich sehen, der den Eltern 24/7 über alle möglichen Kanäle zur Verfügung steht. Erlebe eher das Gegenteil.
Die können Sie dann in ca. 10 Jahren am neurotischen Zittern, Alkoholfahne, Scheidungsgesicht und anderen Syndromen leicht erkennen.
Ausgebrannt halt – und wenn die Kollegen dann ver- und ausgebrannt sind….kommt der stadtviertelweite Spott- und Lästerbonus genau derjenigen obendrauf, für die (und deren Abkömmlinge) sich solche Menschen aufgerieben haben.
Oft genug erlebt.
“Die Erzieher*innen in unserer Grundschule rechnen jedes Elterngespräch auf dem Parkplatz als Arbeitszeit ab, Konferenzzeiten, Veranstaltungen etc. werden minutengenau abgebummelt und während der Ferien handhabt man gern kreative Arbeitszeitmodelle.”
Ganz einfach, die haben verinnerlicht:
“Von der ‘freien’ Wirtschaft lernen, heißt Siegen lernen!”
Als Erzieherin bräuchte man auch genauso viele Ferien, als alle Lehrer es haben.
Dann müssten die Erzieher aber auch den Rest des Jahres mindestens. 50 Std pro Woche arbeiten, incl. Wochenende. Den Aufschrei möchte ich hören ….
Weil? Weil die Schließzeiten im Sommer kürzer sind als die Sommerferien der Schulen. Oder weil der Tarifvertrag die 38,5-Stunden-Woche festlegt.
Völlig richtig nachdem die Grundschullehrer gleichen Lohn wie SEK II Lehrer forderten und sehr oft bekamen (A13 für alle). Ist diese Forderung nur noch logisch!
Ich fordere die W3 Besoldung für alle. Ein Professor ist doch auch ein Pädagoge!
Sie werden es kaum glauben, selbst die tumben HS-Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung HRGe erhalten A13/E13. – Watt et nich allet gibt!
Sie dürfen sich auch gerne angesprochen fühlen, wenn Sie als HS-Lehrkraft für ein A13 für alle Lehrkräfte waren/sind. Ich möchte eine Differenzierung in der Besoldung. Weil Lehrer ist eben nicht gleich Lehrer (Anspruch des Studiums, Qualifikation, Dauer, Arbeitszeit usw. usf.)
Noch viel schlimmer, ich habe Lehrbefähigung von Klasse 1 bis 10 [GHR(HRGe)] und sowohl die Befähigung für den höheren als auch den gehobenen Staatsdienst.
Also ich saß in haargenau denselben Kursen an der Uni wie die Gymnasialstudenten. Es gab keine Unterschiede, ich habe denselben Master mit ebenso vielen Credits, ein gleich langes Ref und eine 2. Staatsprüfung. Ich erfasse derzeit meine Arbeitszeit und bin bei durchschnittlich 47h die Woche. Ich sehe nicht, wo ich weniger als ein Gymnasiallehrer gelernt, studiert, gearbeitet habe.
In Bezug auf das Studium mag das in einigen Bundesländern so sein. Allerdings in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es noch die pädagogischen Hochschulen und dort ist der Anspruch an das Studium eben nicht mit einer „normalen“ Universität zu vergleichen. Das mag ja sein, dass sie auf 47 h kommen. Wissen was ich tracke auch und komme auf 52 h. Aber das ist anekdotische Evidenz. Alle Arbeitszeitstudien zeigen auf, dass Gymnasiallehrer eine höhere durchschnittliche Arbeitszeit haben… Aber ich weiß das ist ein Gegenargument, was wieder nicht zählt. Ich gönne den Grundschullehrkräften usw, dass sie mehr verdienen. Genauso gönne ich das den Erziehern. Dies sind alles berechtigte arbeitnehmerrechtliche Forderungen. Gegen was ich mich mit größter Vehemenz wehre ist diese Gleichmacherei alà wir sind doch alle Lehrer und machen das Gleiche. Auch das Stichwort: Lebenseinkommen ist zu berücksichtigen. Aber egal ich genieße einfach mal mein Popcorn, bevor wieder jemand meint meine Argumente seien dämlich, da diese nicht die Mainstream-Meinung ist!
Gymnasiallehrkräfte arbeiten durchschnittlich halt langsamer.
Aber dafür effektiv;-)
Die Frage ist doch, warum sind die Leute die sich aufregen nicht an die Schulen gegangen, wo sie mehr verdienen, sondern an die Grundschulen
Sicher hatten sie ihre Gründe und das sind wahrscheinlich die Gründe,warum wir an den Berufsschulen und Gymnasien mehr verdienen sollen
Ich kann eine Arbeit nicht einsammeln, damit ich sie im nächsten Jahr nochmal verwenden kann, weil es anscheinend so schwierig ist in der zweiten Klasse eine Klassenarbeit zu erstellen
Als ich das von einem Bekannten erfahren habe, da war ich richtig wütend
Ich muss inzwischen jedes Jahr ein bis zwei neue Arbeiten in ein Fach auf Prüfungsniveau erstellen
Dann kommt das RP un Baden Württemberg noch und will alle alten Prüfungsaufgaben zum Download anbieten
Damit wird es dann noch schwieriger
Aber man kann ja kündige. ich glaube nicht, dass ich in dem Beruf alt werde
Einfach nur dämlich! Daran ist gar nichts logisch. Ein Erzieher ist kein Lehrer und hat nicht studiert.
Die Mehrzahl hat nicht studiert. Im EU-Gebiet gibt es aber viele studierte Erzieher, und es gibt Freizügigkeit. Hinzu kommt der europäische Referenzrahmen für Bildungsabschlüsse. Und jetzt dürfen Sie danach suchen, wie staatlich anerkannte Erzieher in diesem Referenzrahmen eingestuft werden.
Seit wann und warum gibt es ein Studium für den Beruf der Erzieher*in ?
Wieso sollen die zwei Jahre Fachschule für Sozialpädagogik plus zwei Praxisjahre nicht mehr ausreichen ?
Dasselbe könnte man auch für die Grundschule fragen, die früher einmal ™ weit näher am Ausbildungsberuf als am akademischen Studium war.
Früher einmal… da war der Dorfschullehrer zuständig für 60 Kinder und hat in der Schule gewohnt. Sie sind ja lustig, kramen hier Geschichten aus der Mottenkiste.
Das fragen Sie am besten die Erziehungswissenschaftler. Im übrigen sind viele typisch deutsche Berufsausbildungen in europäischen Nachbarländern Studiengänge, die hier anerkannt werden müssen.
Sie haben da was nicht verstanden: “Abba EeeeeUuuui !” gilt nur als ziehend, wenn es darum geht nirmale Bürger zu überwachen (Digutal Service Act), auf Mikroebene zu drangsalieren und zu verkindlichen (Flaschenverschlüsse, Glühbirnen, Bananenkrümmung) oder neue Abzockabgaben/Steuern einzuführen. Oder halt Autos zu verbieten.
Wenn es dagegen ANDERSRUM laufen müsste -Stichwort ARBEITSZEITERFASSUNG- da ist “EU” auf einmal ganz, gaaaanz weit weg.
Achso dämlich:-) Ich hole mir Popcorn und amüsiere mich über die argumentativ dollen Kommentare derer die jetzt den studierten Erziehern das jetzt nicht gönnen, was sie sich selbst vehement gönnen möchten. Und mit Qualifikation, Lernzielen, Arbeitszeit, Studienzeit, Studienschwierigkeit, Anforderungsprofil etc. Argumentieren und genau jene Argumente bei der differenzierten Besoldung zu Gymlehrkräften eben nicht haben gelten lassen. Big Blockbuster!!
Wenn Erzieher 10 Semester an einer Universität studiert haben und anschließend ein 2.Staatsexamen absolvieren und Vater Staat der Arbeitgeber ist und sie verbeamtet sind mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Verbeamtung nach sich bringt, können Erzieher gerne auch A13 verdienen. Das ist aber nicht der Fall! Die Bezahlung der Grundschullehrer versus Gymnasiallehrer ist eine ganz andere Nummer. Die Ihnen zu erklären ist mir jetzt ehrlich gesagt zu mühselig… Holen Sie sich lieber Popcorn und amüsieren Sie sich.
Abgesehen davon kann auch ein Doktorand der Geschichte Taxi fahren. Er verdient trotzdem nicht mehr als alle anderen Taxifahrer. Ich kann auch noch den Doktor der Pädagogik machen. Wenn ich an der Schule bleibe, verdiene ich nicht mehr als meine Kollegen.
Werden Tanzmariechen auch A13 besoldet?
Verstehe diese Frage nicht.
Das hängt von individuellen Umständen ab, die der Tanzmajor persönlich überprüft.
Sage ich auch immer
Ich unterrichte am beruflichen Gymnasium sicherlich eher am Niveau einer Uni als an einer Grundschule
Gleichee Lohn für alle kommt sowieso bald, weil uns allen bald nix mehr übrig bleibt
Ansonsten kann ich nur sagen, warum haben die Grundschullehrer sich nicht für das Gymnasium entschieden, wenn sie das selbe Gehalt wollten?
Ich verstehe diese Debatten nicht. Wenn jemand studiert hat, dann aber in einem Beruf arbeitet, wo das gar nicht notwendig ist, kann ich doch nicht erwarten besser bezahlt zu werden, weil ich studiert habe. Man kriegt halt die Bezahlung, die in diesem Beruf üblich ist, oder verstehe ich da etwas falsch?
Natürlich kann man darüber diskutieren, ob der Erzieherberuf angemessen bezahlt wird oder nicht. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich bei meinen Erzieher-Kolleginnen unbeliebt mache, muss ich doch auch sagen, dass der Lehrerberuf schon noch Mal ‘ne andere Hausnummer ist. Nicht unbedingt von der Stressbelastung her, aber jeden Tag von morgens bis mittags oder nachmittags vor einer Klasse stehen und ein durchstrukturiertes Unterrichtsprogramm durchzuziehen, ist etwas anderes, als Klein- und Vorschulkinder zu betreuen und vielleicht ein/zweimal am Tag ein Beschäftigungsangebot durchzuführen. Nicht falsch verstehen.
Ich war lange genug Erzieherin im Kindergarten, um zu wissen, dass 3-6Jährige in großen Gruppen zu erziehen und zu betreuen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellt. Es ist aber eine andere Art der Herausforderung.
Die leicht versnobte Attitüde, die hier in manchem Lehrerkommentar durchscheint, stößt mir aber auch ein wenig sauer auf. Warum immer gleich so biestig? Es nimmt euch ja keiner etwas weg.
Ich bin nach einunddreißig Jahren aus dem Beruf aufgestiegen und kein Geld der Welt hätte mich davon abhalten können.
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, es nochmal zu versuchen oder es sein zu lassen. Und Seltsamerweise spielt die Bezahlung bei dieser Entscheidung wieder keine Rolle, sondern eher die Frage: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ich es wagen kann, mir das Spektakel nochmal anzutun?
Grundsätzlich finde ich die Bezahlung in diesem Beruf gar nicht so schlecht. Würden wir nach psychischer (und vielleicht auch körperlicher) Belastung bezahlt werden, würden Kitas und Schulen in Zukunft wohl unbezahlbar werden. Gleiches gilt aber auch für andere Berufe – sei es im Gesundheitswesen oder in der Altenpflege.
Mir war es immer wichtiger, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Allzuviel ist da mit den Jahren allerdings nicht passiert. Wenn mich mein Beruf aufgrund schwieriger Arbeitbedingungen krank macht, nützt es wenig, wenn man mir mit ‘nem Bündel Geldscheine vor der Nase rumwedelt.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Es ist völlig legitim sich für eine bessere Bezahlung des eigenen Berufsstandes stark zu machen. Aber bitte nicht in Form von Neiddebatten ala “warum die, warum nicht wir, aber die leisten doch auch nicht mehr, unser Beruf ist doch genauso anstrengend, ihr habt aber nicht studiert…..nöl, nöl, ätschbätsch, zungerausstreck…..”
Echt jetzt. Wem hilft das?
Liebe Marion, Sie sehen das vollkommen richtig!
Based +1
Ach – und was das Thema Akademiesierung des Erzieherberufes betrifft: Auch da geht mit das “Rumgezicke”, das im Artikel angesprochen wird, gehörig auf den Wecker.
Nein, Akademikerinnen sind nicht grundsätzlich praxisuntauglich, aber sie sind auch nicht automatisch die fähigeren Erzieherinnen.
Ich persönlich sehe in einer Akademisierung des Berufes aber keinen Mehrwert. Meiner Meinung nach bildet die Verzahnung von Theorie und Praxis in der Ausbildung eine gute Grundlage, ein Studium halte ich da nicht für zwingend notwendig.
Die Akademisierung verschiedener Berufsfelder führt seit der Bologna-Reform leider dazu, dass ehemals gute und angesehene Ausbildungsberufe eine Entwertung erfahren haben. Zur Folge hat dies, dass ein Großteil der intelligenten jungen Menschen, welche zuvor noch eine Ausbildung angestrebt haben, ein Studium favorisieren, welches, wie oben beschrieben, als Begründung einer besseren Bezahlung dient. Aufstiegsoptionen sind ohne akademische Ausbildung im öffentlichen Dienst mittlerweile auch sehr begrenzt.
Somit folgt vielfach eine tatsächliche qualitative Verschlechterung der pädagogischen Arbeit in den Kindergärten (ohne andere Faktoren ausschließen zu wollen).
Vor 30 Jahren war die Erzieherausbildung in meinem Bundesland noch 5-jährig mit einem vorrausgesetzten Realschulabschluss. Damals wurde auch schon über einen Übergang in eine akademische Ausbildung diskutiert. Stattdessen wurde die Ausbildung jedoch zweigeteilt und verkürzt.
Ich bin beruflich häufig in Kindergärten unterwegs und nehme oft (ohne Pauschalisierung) deutliche Unterschiede zwischen der Arbeit junger Erzieher(innen) und der “älteren” Erzieherinnen wahr, die, neben der langjährigen Berufserfahrung, vielfach Struktur, Pragmatismus und Klarheit in die Ausübung ihrer Tätigkeit einbringen. Die jüngeren Erzieher profitieren hiervon häufig sehr.
Ich denke ebenfalls nicht, dass die Akademisierung der entscheidende Faktor für bessere Qualität ist. Wir hatten bereits gute Ausbildungsformen, bei denen Theorie und Praxis (wie von Marion erwähnt) sinnvoll miteinander einhergehen. Entscheidend ist es fähige, intelligente, reflexionsfähige und anpackende (kompetente) Pädagogen zu generieren. Dies geht nur über echte gesellschaftliche Wertschätzung und über Aufstiegsoptionen für fähige Pädagogen, durch qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten, welche nicht beständig an der gläsernen Decke für Nichtakademiker scheitern. (Im Rahmen des EQR bzw DQR war über eine Creditpointsystem mal eine echte Vergleichbarkeit und somit auch die Motivation zu einem “lebenslangen Lernen” vorgesehen).
Ein akademischer Abschluss erscheint mir dabei in erster Linie eine formelle äußerliche Aufwertung, die an den tatsächlichen Arbeitsbedingungen wenig ändern wird.
Als Lehrkraft habe ich verbringe ich viel Zeit mit Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitung der Unterrichtsstunden.
Das ist zusätzliche Arbeitszeit im “Home-Office”.
Falls Erzieher: innen auch diesen Mehraufwand haben, dann wäre die Forderung einer Annäherung der Gehälter gerechtfertigt.
Meine Frage ist daher: Haben Erzieher: innen den gleiche Mehrarbeit, im Form von vielen Abenden am häuslichen Schreibtisch?
Es gibt selbstverständlich Erzieher, die jede Menge Schreibarbeit – ohne Beamtenpriviligien und die entsprechenden Pflichten, die mal nicht unerwähnt bleiben sollen, daheim leisten. Weil sie in der Kita nicht dazu kommen und es ablehnen, oberflächlich nach Schablonen zu dokumentieren. (Die nicht selten von Akademikern entwickelt wurden).
Gern erinnere ich mich an engagierte Kolleginnen, die mit Akzeptanz der Eltern über längere Zeit nix “systematisch dohumentiert” haben, weil sie es so gesehen haben, dass sie besser mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
Raten Sie mal, welche Erzieherinnen besonders beliebt bei den Kindern waren? Eltern haben entsprechend bevorzugt für deren Gruppe die Kinder anmelden wollen.
Es gibt leider auch berufsmüde “Dokumenteusen”, die die Kinder ziemlich lange Ungelernten und Praktikanten allein überlassen. Aber die Dokus sind suuuper!!!
Der Erzieherberuf ist anspruchsvoll. Aber wenn es losgeht, dass junge Studierte ergänzend zu gesteltzten Gesprächtstechniken auch noch Kindergartenkinder mit Knacklauten gendernd ankommunizieren wollen, dann wird hoffentlich klar, dass weniger Bildungseifer in der Frühpädagogik auch Vorteile haben kann. Ist die Schulreife der Kinder gestiegen, seit nach Bildungsplänen gearbeitet wird? – Liest man hier mit, was Lehrer so posten, damm steht es nicht so gut um die Schulreife.
Wie andere Erzieherinnen es hier scho bekundet haben: Auch ich vermag nicht zu erkennen, dass ein Studium generell einen Mehrwert für die Kinder oder das Team hat. – Allerdings können Träger aufrund des Studium schnell einer studierte Berufsanfängerin die Leitungsverantwortung übertragen. Oder sogar akademisch gebildete Schmalspur-BWLer mit pädagogischen Hintergrund als übergerordnete Leitung für mehrere Kitas einsetzen. – Das empfinde ich als Fehlentwicklung.
Jahrzehntelang haben sich in Kindergärten flache Hierarchien bewährt…. Für Supervision und Mediation werden auch studierte Fachkräfte gebraucht…
Ein Lehrer hat einen Masterabschluss und ein 2. Staatsexamen. Das sind ca. 7 Jahre bis er fertig ist. Ein Bachelorabschluss – wie hier im Artikel erwähnt – dauert nur 3 Jahre. Die Qualifikation ist damit dann doch eine andere. Akademiker ist nicht gleich Akademiker.
Und Lehrkraft ist nicht gleich Lehrkraft!
Na klar, der Lateinlehrer auf dem Gymnasium: das ist natürlich was ganz anderes.
Ist die Reihenfolge nach Ihrer Denkweise so: ganz oben ist der Studienrat/ Gymnasiallehrer, dann kommt der Reallschullehrer/ Hauptschullehrer, dann der Grundschullehrer und dann der Förderschullehrer… also quasi immer dem Lernstand der Schüler entsprechend. Warum verdient dann der Förderschullehrer A13 und ich als Grundschullehrer A12?
Schoko-Popcorn schmeckt vorzüglich 😉
Wenn die Argumente fehlen wird man albern.
Ne dämlich! S.o.
Argumente ihrerseits gibts ja keine bzw. gelten nur, wenn Sie es sagen bzw. Ihre Position stärkt.
Deshalb waren in den allermeisten Fällen die Hofnarren auch wesentlich weiser als ihre Herren.
Ich rate einfach mal ein paar Wochen an eine Berufsschule zu gehen und sich die Anforderungen anzusehen
Man unterrichtet in den verschiedensten Bereichen (Berufsschule, Berufsfachschule, berufliches Gymnasium, Berufskolleg…)
Die meisten Kollegen, die zuvor an einem normalen Gymnasium gearbeitet haben, ergreifen schnell die Flucht, da sie völlig überfordert sind
Und dennoch sollen alle das selbe Gehalt bekommen und das obwohl die Anforderungen sich völlig unterscheiden
Mathe an einer Grundschule kann und unterrichtet offenbar jeder, wenn ich mir die Probleme in meinem Bekanntenkreis so ansehe
Falsch! Lehrer ist Lehrer, es sei denn man ist Yogalehrer. Ansonsten habe ich einen Masterabschluss und ein Referendariat vorzuweisen und dann m u s s A13 gezahlt werden.
Es macht doch einen Unterschied,ob ich Mathe in der ersten Klasse unterrichte oder in der Oberstufe
Es wird sicher nur wenig Grundschullehrer geben, die an einer Oberstufe unterrichten könnten
Lehrer sind eben nicht alle Lehrer
Dafür hast du in der Oberstufe selbständige Menschen vor dir sitzen, um die du dich nicht wirklich kümmern musst. Du bereitest deinen Unterricht vor und die Oberstufenschüler kommen entweder mit oder nicht. Finde ich nicht ganz unangenehm. Kindern die Grundlagen der Mathematik beizubringen, die teilweise ohne Mengenverständnis in die Schule kommen, während andere schon bis 100 rechnen können ist auch eine Kunst und die lasse ich mir garantiert nicht von Gymnasialkollegen klein reden. Ich habe übrigens noch Grund-und Hauptschullehramt studiert, unter anderem Mathematik. Ich habe die gleichen Vorlesungen wie Gymnasiallehrkräfte besucht.
… plus 2 Jahre Vorbereitungsdienst. Den gibt es nämlich nicht nur für Referendare sondern auch für Anwärter.
Ist die ver.di nicht der Vertragspartner für die Angestellten?
https://oeffentliche-private-dienste.verdi.de/mein-arbeitsplatz/bildung-und-erziehung
Einfach einmal bei der ver.di Fragen, warum dies keine Forderung ist, bzw. entsprechende Forderungen nicht umgesetzt werden.
Viele Kommentaren hier postulieren irreführende Dinge. Das Brutto eines Beamten ist nicht mit dem eines Angestellten vergleichbar. Es ist bei gleichem Netto deutlich niedriger wegen dem riesigen Abzügen Sozialbeiträge beim Angestellten. Ein Beamter kann sich also nicht den Brutto-Median in D angucken und daraus schließen, er hätte zu wenig. Ich habe Beamtenrecht und Arbeitsrecht gelernt und bin da im Thema. Ich habe mal alles aufgedröselt und eine Vergleichsrechnung gemacht. Ich habe ein Brutto-Äquivalent errechnet, was der Arbeitgeber tatsächlich zahlt und das auf angestellt umgemünzt – einschließlich eines entsprechend hohen Zuschusses des Arbeitgebers zu einer Betriebsrente, um auf die 71,75% des letzten Gehalts zu kommen. Ein Lehrer mit A13 verdient direkt nach dem Refendariat danach so viel wie ein Angestellten-Brutto von 70.334 jährlich. Er verdient schon beim Berufseinstieg mehr als 75% der Bevölkerung (Angaben destatis zu 2024) und ja schon fast das Doppelte der hier genannten Erzieherin mit ihren 43.000. Dass Lehrer sicherlich noch etwas anspruchsvoller ist sowohl in Ausbildung als auch Tätigkeit, okay. Aber fast das Doppelte wert bereits bei Berufseinstieg ist etwas zu krass. In der Endstufe der Berufserfahrung wären es 86.220 Brutto, hier sind wir beim Doppelten und nur 15% der gesamten Bevölkerung haben 2024 mehr verdient.
Der Vergleich mit IG Metall hinkt auch komplett. Das ist absolute Ausnahme, da sind ja nur 10 oder 15% der Menschen beschäftigt, alle anderen verdienen DEUTLICH weniger. Der Blick auf die TATSÄCHLICHE Einkommensverteilung über ALLE nach destatis ist aussagekräftiger, wo man selbst steht.
Wenn Sie schon das Vollzeit-Brutto des Beamten ausrechnen, müssen Sie auch das Brutto der Erzieherin auf Vollzeit hochrechnen. Und auch bei Erziehern soll es tatsächlich im Laufe des Erwerbslebens Gehaltssteigerungen geben, die haben Sie auch unterschlagen. Ansonsten wurde oben schon ausreichend erklärt, dass ei Lehramt eben einen Masterabschluss erfordert und nicht nur einen Bachelor.
Auf “alle” zu schauen ist doch GERADE in solchen Fällen nicht sachgerecht:
Zwischen “LIDL-Kassenrüberzieher” oder (Extremfall) “Amazonfahrer” und “Abi-Studium-Staatsexamen I-Referendariat-Staatsexamen II-Probezeit” liegen WELTEN.
WENN die Gesellschaft solche Qualifikationsorgien verlangt, dass man einen JAHRELANGEN LEBENSABSCHNITT nur damit verbringt, was die eben “die 85%” NICHT erbringen brauchen – DANN muss selbstverständlich mehr Kohle her.
Verdienen…
– Ärzte
– Anwälte
auch “zu viel” ?
Oh waaaaiiiit, da war ja was bei Ärzten und Anwälten…was war das noch gleich….ach jaaaaa:
Abi-Studium-Examen-SoEinArbeitsdingsda-vollwertiger Abschluss-Probezeit…
Ich sage nur so viel:
Nicht bekloppte Anwälte, die Arbeitsstunden dreschen wie Lehrer LACHEN über Lehrergehalt…
Wenn die Dame bei 85% 4k Brutto verdient, dann wären das bei 100% ca. 4.700 Euro. Also 54k Jahresgehalt mit 30 Jahren. Die Dame leidet unter Realitätsverlust und hat offenbar null Ahnung, was in der Wirtschaft gezahlt wird.
kinder sind Unsere Zukunft.
Da die meisten Eltern mehr Ansprüche und Erwartungen haben und die arbeit mit volles Verantwortung ist deswegen sollten die Regierungschef da mehr investieren.
Es fing damit an, dass ein Richter behauptet hat, dass alle Lehrer unterrichten und damit gleich verdienen müssen
E
Dann muss man sich über diese Diskussionen nicht wundern
Ich habe bisher nie gehört, dass alle Polizisten gleich verdienen müssen
Ein Rat verdient dort eben auch mehr
Ein Lehrer der Studienrat ist, will man aber künftig am liebsten gleich bezahlen, da er ja unterrichtet und der Richter hat es ja so begründet
Und jetzt kommen die nächsten, die sich denken, ich mache irgendwas mit Kindern , dann will ich doch auch so viel verdienen
Man kann jedem nur raten nicht mehr in seine Zukunft zu investieren
Sollen sie ihre Freizeit genießen. Durch Leistung viel zu erreichen, wird in Deutschland immer schwieriger, da man es am Ende nicht anerkennen will
Wussten Sie, daß die Dozenten an der Uni, welche die Lehrer ausbilden, in der Regel einen Doktortitel haben und jahrelange Erfahrung, weniger verdienen als der von ihnen ausgebildete Lehrer am Gymnasium nach seiner Verbeamtung verdient? Ist vielleicht noch unfairer, oder?