BERLIN. Weniger Kinder, also weniger Schüler – da müsste der Lehrkräftemangel doch bald Geschichte sein? Ganz im Gegenteil, sagt der renommierte Bildungsforscher Prof. Klaus Klemm. Auch wenn die Schülerzahlen bis 2035 deutlich zurückgehen, werde Deutschland weiterhin auf einen eklatanten Mangel an Lehrerinnen und Lehrern zusteuern. Und er wirft der Kultusministerkonferenz (KMK) vor, die Lage zu beschönigen.
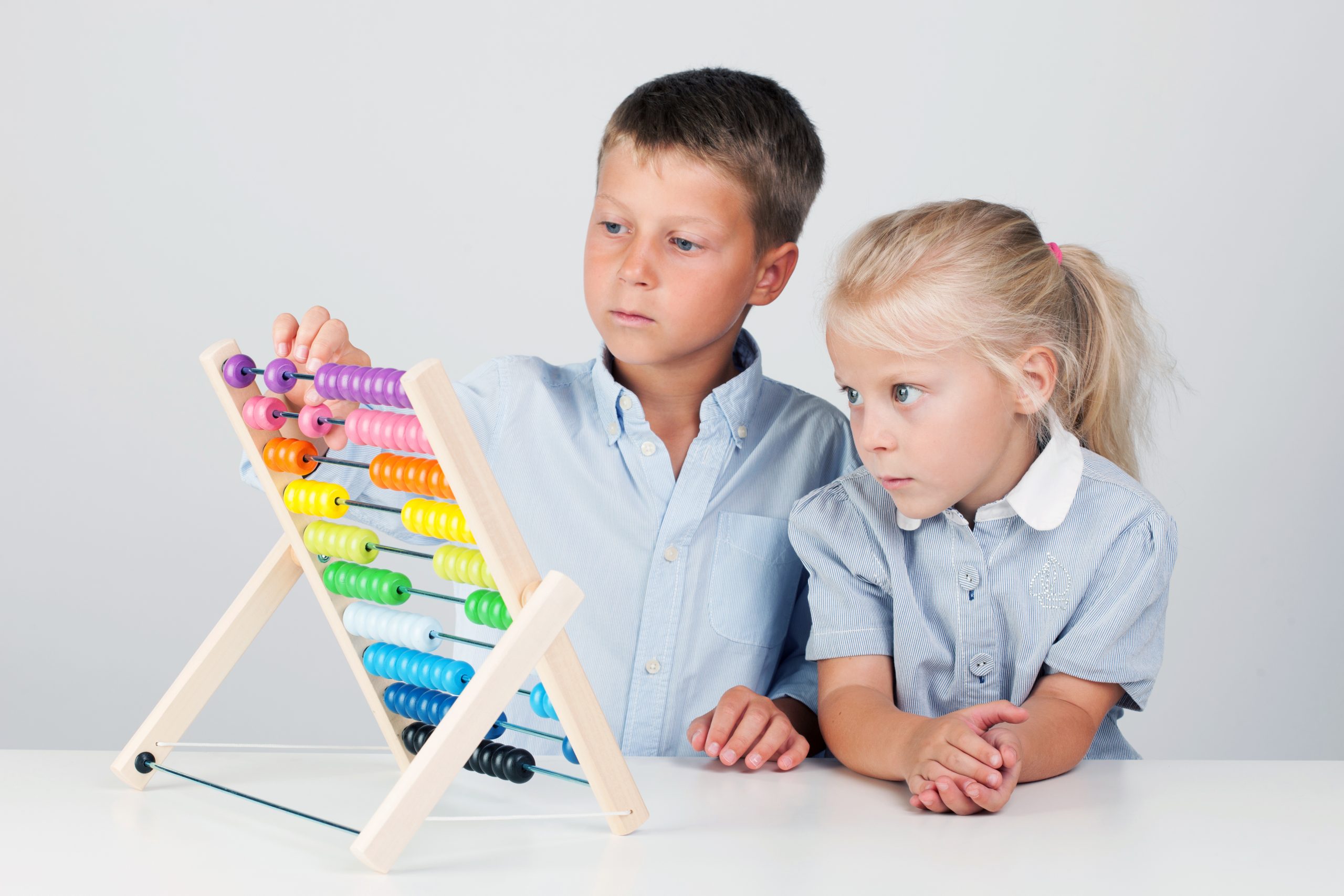
Laut einer Modellrechnung der KMK fehlen bis 2035 rechnerisch etwa 50.000 Lehrkräfte. Klemm widerspricht gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk vehement: Seine eigene Kalkulation geht von rund 75.000 fehlenden Lehrkräften aus. Das Problem liegt darin, dass die KMK mit viel zu hohen Zahlen beim Berufsnachwuchs rechnet. „Die Nachrückerzahlen sind bei der Kultusministerkonferenz für mich nicht nachvollziehbar, zum Teil sogar unseriös“, sagt Klemm und betont: „Fest steht, dass es in Deutschland noch einige Jahre zu wenige Lehrer geben wird.“
Schülerzahlen sinken – und doch bleibt der Mangel
Tatsächlich schrumpfen die Kinderzahlen drastisch. Von 2021 bis heute seien bundesweit rund 160.000 Kinder weniger geboren worden, rechnet Klemm vor. Das bedeutet: weniger Einschulungen, kleinere Jahrgänge, weniger Grundschüler.
Doch warum löst dieser Rückgang den Lehrkräftemangel nicht?
- Rechtsanspruch auf Ganztag: Ab 2026 hat jedes Grundschulkind Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Schon heute fehlen bundesweit Erzieherinnen und Erzieher – und auch Lehrkräfte sollen diese Betreuung mit absichern. Damit wächst der Bedarf trotz sinkender Schülerzahlen.
- Ungleiche Verteilung: Während im Osten die Schülerzahlen massiv zurückgehen, steigen sie in Städten wie Hamburg weiter. Der Bedarf bleibt also regional sehr unterschiedlich – Lehrerüberschüsse in Brandenburg lassen sich nicht einfach nach Hamburg verschieben.
- Schulformen unterscheiden sich: Entlastung ist höchstens im Grundschulbereich in Sicht. In den meisten anderen Schularten – insbesondere in der Sekundarstufe I ohne Gymnasien – bleibt der Bedarf hoch.
- Mehr Unterrichtsbedarf pro Kind: Ganztag, Inklusion, Sprachförderung, Integration – die gesellschaftlichen Anforderungen an Schule wachsen. Damit steigt der Lehrerbedarf je Schüler, auch wenn die Gesamtzahl der Kinder sinkt.
Klemm fasste es gegenüber dem Deutschen Schulportal im vergangenen Jahr so zusammen: „Was kann man tun, wenn jedes Jahr 100.000 Kinder weniger in die Grundschule gehen? Denken Sie an den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Alle Expertinnen und Experten sagen, dass uns dafür die Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Wie könnten da die überschüssigen Grundschullehrkräfte zum Einsatz kommen?“
Ostdeutschland im freien Fall
Besonders düster sehen Klemms Prognosen für die ostdeutschen Länder aus. Brandenburg etwa verliert bis 2035 fast die Hälfte seiner Grundschulkinder – die KMK hingegen rechnet nur mit einem Rückgang um rund 16 Prozent. Für Klemm ist klar: „Wenn es in den kleinen Orten keine Apotheke, keinen Arzt und keine Grundschule mehr gibt, wandern die letzten Familien in die Ballungsräume ab“, wie er gegenüber der Zeit im vergangenen März erklärte.
Damit wird der Lehrerbedarf aber zunächst mal nicht kleiner, sondern schlicht ungleich verteilt: leerstehende Schulgebäude im ländlichen Raum, übervolle Klassen in den Städten.
Seiteneinsteiger: unverzichtbar, aber problematisch
Angesichts des Mangels setzen viele Länder massiv auf Seiteneinsteiger. Doch auch hier bremst Klemm den Optimismus. „Niemand kann in ein paar Wochen Lehrer werden“, so warnte er unlängst im Spiegel. Ein grundständiges Lehramtsstudium vermittle nicht nur Fachwissen, sondern auch didaktische, pädagogische und psychologische Grundlagen.
Die Forschung zeigt ihm zufolge, dass Unterricht durch Quereinsteiger Schwächen hat: „Wir wissen durch die Studie ‚IQB-Bildungstrend 2018‘, dass der Unterricht von quereinsteigenden Lehrkräften in Mathematik, Chemie und Physik bei Schülerinnen und Schülern zu geringeren Kompetenzen führt als der von Lehrkräften mit einem klassischen Lehramtsstudium.“
Besonders brisant: Schon jetzt stammen zehn Prozent aller Neueinstellungen aus dem Quereinstieg, in Niedersachsen waren es zuletzt sogar über 50 Prozent. Damit wächst eine Generation von Lehrkräften heran, die mit geringen oder stark verkürzten pädagogischen Vorerfahrungen unterrichtet.
Klemm sieht die Gefahr einer „Zweiklassengesellschaft“ im Lehrerzimmer: Einerseits voll ausgebildete Lehrkräfte, andererseits Seiteneinsteiger, die schlechter bezahlt werden, aber oft an den schwierigsten Schulen arbeiten – dort, wo eigentlich die bestausgebildeten Lehrkräfte gebraucht würden. „Schon jetzt wird in den Schulen gleiche Arbeit ungleich entlohnt. Dass dies in Zeiten des Lehrermangels noch verstärkt wird, ist die falsche Entwicklung.“
Sein Fazit: Da der Quereinstieg unverzichtbar geworden ist, brauche es endlich verbindliche Standards. Vorbereitungsprogramme, enge Begleitung durch erfahrene Lehrkräfte und eine Angleichung der Bezahlung nach einer gewissen Zeit im Dienst seien notwendig, um die Qualität zu sichern und Ungerechtigkeiten zu vermeiden.
Klemms Fazit: Flexible Personalpolitik statt Schönrechnerei
Klemms zentrale Botschaft (im Interview mit dem Deutschen Schulportal) lautet: Weder die offiziellen Prognosen der KMK noch hektische Notlösungen beim Quereinstieg lösen das Problem.
Er fordert eine flexible Personalpolitik, die auf neue Entwicklungen reagieren kann: „Ich würde darüber nachdenken, was man macht, wenn der Bedarf höher oder niedriger ist als prognostiziert. Welche Optionen habe ich im System eingebaut, auf die ich bei Engpässen zurückgreifen kann? Wie kann ich Leute, die nicht auf Lehramt studiert haben, sinnvoll nachqualifizieren? Ich muss die Schulen mit Lehrkräften versorgen – und ich muss auch den Lehrkräften, die ich mit dem Versprechen angeworben habe, dass wir sie brauchen, eine Option geben. Diese Möglichkeiten für zu viel oder zu wenig, die braucht das System.“ News4teachers










“Während im Osten die Schülerzahlen massiv zurückgehen, steigen sie in Städten wie Hamburg weiter.”
Es wäre schade, wenn “im Osten” – am 3.10. … manche Dinge kann man sich nicht ausdenken 🙁 – die Zahl der Lehkräfte dazu reduzuert würde.
UM mit Hamburg zu konkurrieren, können eine familienfreundliche Politik und bezahlbarer Wohnraum einen Beitrag leisten! Die Schulen können hier hervorstechen, wenn sie nicht vorher kaputtgespart werden.
Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag:
“Sie dienten mir gerne bei jedem Gedicht,
die Substantive und Verben,
doch heute gehorchen sie mir leider nicht –
ich möchte am liebsten sterben.”
(Heinz Erhardt)
Bei Ihnen kommen “solche Tage” allerdings ziemlich oft vor! Was soll Ihr wirrer Kommentar aussagen?
Zwei Foristen ( = “Daumen hoch”) scheinen den Kommentar ja verstanden zu haben. Können diese vielleicht beim “Übersetzen” helfen? Ich verstehe es jedenfalls nicht, sorry!
Die Lehrereinstellung ist eine bezogen auf Prognosen für 10-40 Jahre in die Zukunft. Man kennt ja die Schülerzahlen für bis 2035 an allen Schulformen ziemlich sicher. Somit kann man das ganze extrapolieren und plant mit Lehrerzahlen für 100% Besetzung unter den prognostizierten Schülerzahlen von 2045. So entsteht dann aktuell ein Lehrermangel. Würfeln ist kaum weniger zuverlässig.
Leider ist es nicht so einfach. Das liegt auch daran, dass
a) Migrationsbewegungen (national wie international)
b) Teilzeitwünsche
schlecht planbar sind.
Ich habe nie behauptet, dass die Prognosen zutreffen werden. Ich habe nur argumentiert, wie die Bundesländer planen.
Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
Besonders in einem System Schule, bei dem in deutlich kürzerer Zeit herumreformiert wird, als die Auswirkungen wirklich sichtbar werden.
Das begünstigt aber die Evaluation.
Das war ja aber auch alles so unvorhersehbar! Grrr!
„Was kann man tun, wenn jedes Jahr 100.000 Kinder weniger in die Grundschule gehen? Denken Sie an den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Alle Expertinnen und Experten sagen, dass uns dafür die Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Wie könnten da die überschüssigen Grundschullehrkräfte zum Einsatz kommen?“
GAR NICHT!!!
BETREUUNG ist nämlich nicht mein Job.
Dringender ist doch die Frage:
Was könnten eigentlich die sehr, sehr zahlreichen Bildungswissenschaftlern Produktives tun?
Vorschläge:
– abends im Institut noch mal nass durchwischen
– Müll im Park des Instituts sammeln
– die Fenster der Orangerie des Instituts putzen
Und das Symbolfoto soll die Digitalisierung in Deutschland repräsentieren? Bente-Emily und Luca-Pascsl vor dem neuen, nachhaltigen Taschenrechner?
zuvor
„Was kann man tun, wenn jedes Jahr 100.000 Kinder weniger in die Grundschule gehen?”
Man sieht recht deutlich:
Es gibt gar keine Not, nicht mal einen Anlass, öffentlich und laut darüber nachzudenken, in welchen NEUEN BEREICHEN man angeblich “frei werdende” oder “überschüssige” Lehrerstunden künftig einsetzen könnte, denn:
Es gibt keine Lehrerstunden an der Grundschule, die “frei” wären oder würden.
Stand heute fehlt es hinten und vorne – siehe meine Liste.
Wenn nun künftig ein paar weniger Kinder kommen sollten, MUSS diese demographische Rendite zu 100% an den Grundschulen verbleiben, um wenigstens einige (!) meiner Punkte ein bisschen (!) zu mildern – alles andere wäre komplett ignorant, mit Tendenz zur Menschenverachtung.
HIER GIBT ES GAR NICHTS ZU VERTEILEN.
BITTE GEHEN SIE WEITER!
Danke.
Die genannten Aufgaben gehören als Qualitätsstandard bundesweit festgelegt,
dazu in jeder Schule Lehrkräfte, die sich z.B. um die Organisation von Inklusion etc. kümmern können, mit Ausgleich für die zusätzlichen Aufgaben – zwingend notwendig, wie bei vielen anderen Aufgaben auch.
Vor 10 Jahren gab es in NDS bereits die Arbeitszeitstudie, nachfolgend wurden Entlastungen ausgelobt, die nicht umsetzbar waren, weil der Lehrkräftemangel so groß war. Zum Zeitpunkt der Erhebung begann die Umsetzung der Inklusion erst und war noch nicht für alle Klassenstufen festgelegt, die FöS-Lernen hatte Bestand.
Setzen wir doch umgehend in allen BL die Arbeitszeiterfassung für Lehrkräfte um, entsprechend geltendem EU-Recht.
Danach können wir noch einmal über Lehrkräftemangel sprechen, der dann noch offensichtlicher wird, da Lehrkräfte dringend entlastet werden müssen.
So nämlich!
Endlich auch in Baden-Württemberg
A13 für Grundschullehrkräfte!
“Wenn nun künftig ein paar weniger Kinder kommen sollten, MUSS diese demographische Rendite zu 100% an den Grundschulen verbleiben, …”
Ist noch nie passiert und wird auch diesmal nicht passieren. Wer darauf hofft, ist ein REALITÄTSVERWEIGERER!
Trotzdem ist es wichtig, dass man dem Eindruck, der hier erweckt wird (es gäbe was zu verteilen), DEUTLICH entgegen tritt.
Große Hoffnung, dass das Irrationale nicht passieren wird, habe ich nicht.
Aber wer das Irrationale anstrebt oder umsetzt, soll sich wenigstens nicht auch noch mit pseudorationalen Pseudogründen aus der Verantwortung stehlen können oder kurz: sich wenigstens schlecht fühlen bzw. sich meiner Verachtung sicher sein.