MAINZ. Wie gelingt der Wandel vom Klassenzimmer zur Lernlandschaft im Alltag – und was brauchen Lehrkräfte, um ihn mitzutragen? Im zweiten Teil seines Gastbeitrags führt Timo Schlosser, Referent und Berater für pädagogischen Schulbau am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz, seine Analyse des notwendigen Paradigmenwechsels im Schulbau fort. Nachdem er gezeigt hat, warum der traditionelle Klassenraum ausgedient hat, beschreibt er nun, wie Schulen offene Lernumgebungen erfolgreich gestalten können – und welche fünf Faktoren entscheidend sind, damit daraus kein Chaos, sondern ein neues Gefühl der Leichtigkeit im Lernen entsteht.
Hier geht es zurück zum ersten Teil des Gastbeitrags.

Wie jeder Veränderungsprozess wird auch der Schulbau von Bedenken, Sorgen und Ängsten begleitet. Eine häufig geäußerte Sorge von Lehrkräften ist, dass durch offene Gebäudestrukturen mit offenen Flächen und Glaselementen die Arbeitsbelastung steigt. Müssen nun größere Gruppen oder mehrere Klassen gleichzeitig beaufsichtigt werden? Wird es (noch) lauter sein als im Klassenraum? Wie verhält es sich mit der Aufsichtspflicht, wenn Lernende ihren Lernort selbst wählen können?
Um diesen durchaus berechtigten Bedenken zu begegnen, hilft es, neue Erfahrungen bei Hospitationen in Schulen mit offenen Lernumgebungen zu machen. Gute Beispiele hierfür finden sich in Rheinland-Pfalz am Gymnasium Mainz Mombach, an der Berufsbildenden Schule in Westerburg oder auch an der Freiherr-vom-Stein Grundschule in Koblenz. Die Beobachtungen dabei sind oft überraschend.
Als erstes fällt auf, dass das ganze Gebäude in Bewegung ist. Lernende können ihren Lernort zu vielen Zeiten frei wählen und sitzen nicht in Klassenräumen. Viele Besucherinnen und Besucher haben daher den Eindruck, dass gerade große Pause ist. Doch schnell wird klar, dass die Lernenden, die in den Marktplatzräumen an Gruppentischen oder im Lernbüro alleine an ihrem persönlichen, individuellen Schreibtisch sitzen, tatsächlich am Lernen sind.

Was dann häufig überrascht, ist das „Gefühl der Leichtigkeit“: Entspannte Gespräche in kleinen Gruppen, fokussiertes Arbeiten an selbst dekorierten Schreibtischen und gemütlich in einer Sofaecke liegen beim Vokabellernen. Was fehlt, ist die Langweile und die aus ihr resultierenden Störungen eines Unterrichts, der versucht, dreißig unterschiedlichen individuellen Lerntempi und Lernstilen gleichzeitig gerecht zu werden. An seine Stelle tritt ein individuelles Lernen, das durch eine lernförderliche Struktur und eine enge persönliche Lernbegleitung unterstützt wird. An die Stelle des frustrierenden „allen gerecht werden Müssens“ tritt für die Lehrkräfte das positive Gefühl, in persönlichen Gesprächen mit den Lernenden mit diesen in einer Resonanz zu sein. So erleben die Lehrkräfte die individuellen Lernfortschritte direkt und unmittelbar. Dies ist genau der Grund, aus dem sich viele Lehrkräfte ursprünglich für ihren Beruf entschieden hatten.
Es gibt fünf Erfolgsfaktoren, die an Schulen mit selbst organisiertem Lernen zu diesem „Gefühl der Leichtigkeit“ führen.
- Zeitweise Auflösung der Lerngruppen
Traditionell werden Schülerinnen und Schüler nach ihrem Geburtsjahr in Klassen eingeteilt. Die Klasse hat dabei die wichtige Funktion einer sozialen Gruppe. Sie bietet ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sie ermöglicht das Erlernen eines verantwortungsvollen Umgangs miteinander in einem geschützten Rahmen. Bei anderen Aktivitäten ist jedoch die Zugehörigkeit zu einer festen sozialen Gruppe nicht entscheidend oder sogar hinderlich. So muss beispielsweise ein Arbeitsblatt nicht zwingend zeitgleich in einem festen Klassenverband bearbeitet werden. Einige Grundschulen setzen daher gerade im Mathematikunterricht auf das Drehtürmodell. Alle Klassen und Jahrgänge haben in den gleichen Stunden im Stundenplan Mathematik. So wird in diesem Fach, in dem häufig sehr unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten zu beobachten sind, eine Jahrgangsmischung in mehrere Lerngruppen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus möglich. Ein Schüler der dritten Klasse kann so, je nach persönlichem Lerntempo, bereits an Themen der vierten Klasse arbeiten oder noch den Stoff der zweiten Klasse wiederholen und vertiefen. Ein wichtiger Aspekt ist hier auch das voneinander und miteinander Lernen, so wie es in Familien zwischen älteren und jüngeren Geschwistern seit jeher üblich ist.
- Veränderung der Zeitstruktur
Wie früher im Stahlwerk verkündet auch heute noch an vielen Schulen ein Tonsignal den „Schichtwechsel“. Egal, wie vertieft Schülerinnen und Schüler gerade in ihre Aufgabe sind, wenn es erklingt, müssen sie aufhören. Umgekehrt müssen auch dann, wenn alle Aufgaben schon bearbeitet wurden, die letzten sieben Minuten der Stunde noch irgendwie gefüllt werden. Selbstgesteuertes Lernen passt nicht in das starre Raster eines Stundenplans. Auch hier gilt es – ähnlich wie bei den Lerngruppen – zu schauen, wann feste Zeitstrukturen wichtig sind (Zeiten für Sport oder gemeinsames Musizieren) und wann eine freie Zeiteinteilung besser für den Lernerfolg jedes einzelnen ist.
- Lerncoaching
Selbstgesteuertes Lernen bedeutet nicht, dass jeder nur das macht, worauf er gerade Lust hat. Damit das Wann und Wo individuell so gewählt werden kann, dass es zum eigenen Lernstil passt, muss es einen festen Rahmen geben. Wochenpläne, Lernziele und Lerntagebücher geben Struktur und Orientierung. Um in diesem Rahmen erfolgreich zu sein, gibt es im besten Fall einmal pro Woche ein kurzes Coachinggespräch mit einer Lehrkraft, in der das eigene Lernen reflektiert wird und so Verbesserungen möglich werden.
- Verhaltensregeln, die an die Räume geknüpft sind
Häufig sind an Schulen die Verhaltensregeln an die Lernsituation oder die Lehrkraft geknüpft. Wenn stille Einzelarbeit im Klassenraum angesagt ist, dann darf man dort, auch wenn man schon alle Aufgaben bearbeitet hat, nicht die Ergebnisse mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in Kleingruppen besprechen.
 Die Schülerinnen und Schüler wissen sehr genau, bei welcher Lehrkraft man „gefahrlos“ unter dem Tisch auf dem Handy spielen kann und bei welcher nicht. In offenen Systemen sind die Verhaltensregeln hingegen an die Räume und somit deren Funktion geknüpft. Im Lernbüro herrscht Stille, da hier konzentriert gearbeitet wird. Wer reden und sich austauschen möchte, darf das, nur eben nicht im Lernbüro, sondern im Marktplatz-Raum. Immer wieder interessant zu beobachten ist, wenn diese Regeln von Schülerinnen und Schüler selbst durchgesetzt werden. Mehr oder weniger deutlich werden Personen, die sich lautstark unterhalten, von Lernenden, die hier konzentriert an ihren persönlichen Schreibtischen arbeiten, aus dem Lernbüro verwiesen.
Die Schülerinnen und Schüler wissen sehr genau, bei welcher Lehrkraft man „gefahrlos“ unter dem Tisch auf dem Handy spielen kann und bei welcher nicht. In offenen Systemen sind die Verhaltensregeln hingegen an die Räume und somit deren Funktion geknüpft. Im Lernbüro herrscht Stille, da hier konzentriert gearbeitet wird. Wer reden und sich austauschen möchte, darf das, nur eben nicht im Lernbüro, sondern im Marktplatz-Raum. Immer wieder interessant zu beobachten ist, wenn diese Regeln von Schülerinnen und Schüler selbst durchgesetzt werden. Mehr oder weniger deutlich werden Personen, die sich lautstark unterhalten, von Lernenden, die hier konzentriert an ihren persönlichen Schreibtischen arbeiten, aus dem Lernbüro verwiesen.
- Graduierungssysteme
Eine häufig geäußerte Sorge von Lehrkräften bei der Einführung offener Raumstrukturen ist, wie die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann. Wichtig dabei ist das Verständnis, dass Aufsicht nicht bedeutet, jede Schülerin und jeden Schüler jederzeit vom Pult aus im Blick haben zu müssen. Die Aufsichtspflicht orientiert sich am Alter und der individuellen Reife der Kinder. Erstklässler benötigen eine engmaschigere Beaufsichtigung als Oberstufenschülerinnen und -schüler. Dabei geht es um das Zutrauen, ob ein Kind in der Lage ist, verantwortungsvoll mit den ihm gegebenen Freiheiten umzugehen.
Dies ist eine Frage, die sich Eltern häufig stellen: Ist das eigene Kind beispielsweise schon so weit, alleine zu einer Freundin zu gehen, die zwei Straßen weiter wohnt? Basis für dieses Zutrauen ist das zuvor beobachtete Verhalten. Daher weiß jede Lehrkraft sehr genau, wen sie problemlos die vergessenen Fotokopien holen schicken kann und wen besser nicht.

In Schulen, in denen offen gearbeitet wird, erfolgt eine Abbildung dieses Zutrauens häufig über Graduierungssysteme. Dabei werden Schülerinnen und Schülern in Stufen unterschiedlicher Freiheitsgrade eingeteilt. Dies geschieht auf Basis des Zutrauens in ihren verantwortungsvollen Umgang mit diesen Freiheiten. So ist es für einen Schüler, der sich häufig ablenken lässt sinnvoll, wenn er in Sichtweite einer Lehrkraft arbeiten muss, während eine Schülerin, die bewiesen hat, dass sie ihre Aufgaben gewissenhaft erledigt, sich ihren Lernort in den Freiarbeitsphasen selbst wählen darf. Häufig gehen dabei mehr Freiheiten auch mit mehr Verantwortungsübernahme für die Gruppe einher. Entscheidend ist, dass Graduierungssysteme nicht als Sanktionierungssystem gesehen werden, sondern als Werkzeug, durch das jeder Lernende die seinen Entwicklungsstand angemessene Unterstützung im Lernprozess bekommt.
Grundlage für diese fünf Erfolgsfaktoren ist das Zutrauen. Das Zutrauen in die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, ihr Lernen selbstverantwortlich zu organisieren. Das Zutrauen der Lehrkräfte, sowohl durch durchdachte Rahmenbedingungen als auch in direkten persönlichen Rückmeldungen die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen. Das Zutrauen aller in der Schulgemeinschaft, als multiprofessionelles Team gemeinsam eine Lernumgebung zu schaffen, die es jedem Kind ermöglicht, seinen individuellen Lernprozess erfolgreich zu gestalten. News4teachers
Hier geht es zurück zum ersten Teil des Gastbeitrags.
Hier geht es zu allen Beiträgen des Themenmonats “Schulbau & Schulausstattung”.
Und noch ein Rekord… Das neue Redaktionskonzept von News4teachers zieht!


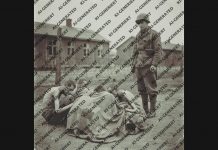



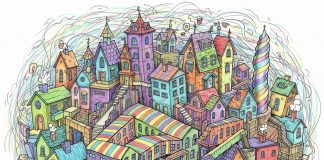



Bei mir an der Berufsschule schmieren die Schüler bei Arbeitsaufträgen meist schnell irgendwas hin, gerade die mit eh schon schlechten Noten. Man sollte sich daher nicht zuviel von offenen Lernformen erwarten.
Kenne ich auch: Je schlechter die (aus der falschen Arbeitseinstellung resultierenden) Noten, desto schlechter kommen die Schüler mit offenen Arbeitsaufträgen klar.
Sie sprechen vom Ende her,
aber Danke, dass auch Sie dringenden Handlungsbedarf der jetzigen Situation bei Ihnen einräumen 😉
Ja klar. Es bedarf mehr Frontalunterricht.
Genau!
Es ist halt wieder eine der Säue, die immer wieder durch das pädagogische Dorf getrieben werden. Es geht nichts über einen gut strukturierten Frontaluntericht, der anschaulich und mit aufeinder aufbauenden Fragen arbeitet, in den ab und zu eine Still-, Partner- oder Gruppenarbeit integriert werden können, und bei dem Ende ein übersichtliches, logisch aufgebautes Tafelbild steht.
Viele Neuerungen sind im Grunde genommen pädagogische Effekthascherei ohne wirklichen Nutzen für die Schülerinnen und Schüler.
Ich weiß, dass offener Unterricht oft mit “alle arbeiten alleine und jeder macht was er will” gleichgesetzt wird. Und es mag sein, dass es oft so gemacht wird. Allerdings habe ich an einer Schule mit offenem Konzept hospitiert und sie werden staunen: Es gibt kaum etwas frontaleres als offener Unterricht. Nur wird der Frontalunterricht auf die Schüler beschränkt, die auch weit genug im Thema sind. Heißt: Es gibt Standards an denen die Schüler gemessen werden und dementsprechend werden sie auch gefördert. Es wird ganz klar gesehen, wo jeder steht und somit an den Dingen gearbeitet, die notwendig sind. Hat ein Schüler den Hunderterraum noch nicht erschlossen, arbeitet er logischerweise nicht im Tausenderraum.
Lesen Sie dazu bitte die Meinung von Rüdiger Vehrenkamp.
Ihr Beitrag ist recht idealistisch; es dürfte schwer sein, ihn an vielen Schulen zu etablieren ( Schülerschaft, räumliche, personelle und technische Ressourcen…).
Es gibt kaum etwas frontaleres als offener Unterricht. Nur wird der Frontalunterricht auf die Schüler beschränkt, die auch weit genug im Thema sind.
Oha, dann gibt es also Schüler, die hinterherhinken – und selbst für ihren Anschluss sorgen müssen. Die Schnellen, also hier wohl Leistungsstarken, werden frontal gefördert.
Sollte man nicht eher umgekehrt vorgehen und die Schwächeren frontal unterrichten und den Starken die Freiheiten einräumen, mit denen sie i. A. besser umgehen können?
Ich erwarte nicht zu viel, sondern gar nichts. Im Gegenteil. “Das Zutrauen in die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, ihr Lernen selbstverantwortlich zu organisieren”, ist keine neue Idee, sondern eine aufgewärmte von vor mehr als 10 Jahren.
Wären die Ergebnisse so überzeugend gewesen, wie damals schon behauptet, wäre ich heute vermutlich weniger skeptisch. Warum hat sich SOL im Verlauf der Jahre nicht stärker durchgesetzt? Heute wirkt diese Unterrichtsform so, als würde mit ihr nur alter Wein in neuen Schläuchen (Lernräumen) dargeboten.
https://www.news4teachers.de/2012/12/modellversuch-selbstorganisiertes-lernen-zeigt-gute-ergebnisse/
Der Artikel war damals übrigens, wenn ich nicht irre, der meistdiskutierte des Jahres 2012. Ich habe viele der wohltuend sachlichen Kommentare noch einmal mit großem Interesse gelesen.
“Warum hat sich SOL im Verlauf der Jahre nicht stärker durchgesetzt?”
Mich wundert das gar nicht. Unser Bildungssystem ist ein großer Tanker oder vielmehr 16 große Tanker, die immer wieder von unterschiedlichen politischen Kapitänen gelenkt werden. Das dauert, bis sich da mal was durchsetzt. Außerdem ist Deutschland auch nicht gerade für seinen wagemutigen Tatendrang bekannt. Zudem braucht es dazu überzeugte LuL, ihre Rolle zu überdenken und zu verändern – vor allem mit der Kraft, dass noch zu schaffen – diese scheint es auch nicht im Überfluss zu geben.
Aber so langsam setzt sich das Konzept hier und da durch und einige Schulen wagen eigenständig den Schritt. Hoffe, es folgen noch mehr. Spricht nichts gegen einen “Mischwald” in der Schullandschaft.
“Warum hat sich SOL im Verlauf der Jahre nicht stärker durchgesetzt?”
Könnte auch daran liegen, dass manchen Lehrkräfte Effektstärken von 0,03 für schülergesteuertes Lernen und 0,26 für individualisiertes Lernen nicht unbedingt wirkmächtiger erscheinen als die 0,56 der direken Instruktion.
Wenn es “nur” bedeutet, dass motivierte und clevere Kids nicht aufgehalten werden und endlich ihr Potenzial ausschöpfen können, hat es sich für mich schon gelohnt. Wie unten schon geschrieben, sollen das ja nicht alle so machen. Aber mehr Schulen mit dem Angebot wären toll.
Finnland hatte ja mal diesen wagemutigen Weg beschritten. Inzwischen gilt dieses Prinzip als Ursache dafür, dass sich die Leistungen dort verschlechtert haben.
Sollte man mal drüber nachdenken.
Ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Weg für ALLE SuS – weder gleichschrittige Instruktion noch SOL. Daher bin ich für ein breites Angebot in jedem Bundesland und freue mich, dass immer mehr auch SOL wagen.
Was effektive Einflussfaktoren für den Lernerfolg sind findet man hier:https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/
Schon den neuen Podcast von Blume und Hattie gehört? Darin betrachtet Hattie “seine” damaligen Bewertungen heute eher kritisch. Wirklich interessant.
Bitte stellen Sie doch einmal Belege dazu hier ein. Ich glaube schon, dass Hattie selbst reflektierend arbeitet, was man von den Koryphäen des Grundschulverband nicht sagen kann.
https://www.news4teachers.de/2025/10/john-hattie-rechnet-mit-dem-individualisierungs-hype-beim-unterricht-ab-das-groesste-problem-liegt-in-der-ueberbetonung-des-alleinarbeitens/#comment-747583
Dazu Hattie zum sog. individualisierten, selbst gesteuerten Lernen und deren Effektstärke: “Seine Datenlage ist eindeutig: Die Effektstärken – also der statistische Grad, mit dem ein pädagogischer Ansatz Lernerfolge beeinflusst – liegen laut Hattie im Durchschnitt bei 0,03 für schülergesteuertes Lernen und 0,26 für individualisiertes Lernen – also deutlich unter der Schwelle von 0,4, die er als Grenze für eine „bedeutsame Wirksamkeit“ definiert.
„Kurz gesagt“, so Hattie, „der Hype um individualisiertes und personalisiertes Lernen übersteigt die Stärke der Forschungsergebnisse bei Weitem. Das Versprechen der Individualisierung ist größtenteils rhetorisch.“
Einige Tanker sind aber auf Grund ineffektiver Lernmethoden, die sich gegen die Methode, wie unser Gehirn sich Kulturtechniken aneignet richten, in eine deutliche Schieflage geraten. Frommer Glaube an eine Besserung mit einem Umlernen hilft nicht weiter, genau so wenig wie seltenes Wiederholen der Lerninhalte oder oberflächliches Bearbeiten von Grundlagen.
Das gewählten Symbolbild zeigt genau das, was diese “Zukunftsplanungen” für die meisten LuL ubd SuS weiterhin bleiben werden:
Wolkenkuckucksheim!
Mir sind auch die oft (wahrscheinlich ungewollt) treffend gewählten Bilder aufgefallen. Da muss die Bild-“KI” wohl noch ein bisschen ge-faktencheckt werden. 😉
Unsere Bilder sind keineswegs ungewollt treffend – sie sind meist als ironische Kommentare zu verstehen. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ihr seid ja ganz schlimme Schlingel!! 😉
Liebes News4Teacherteam,
in diesem Beitrag wird offensichtlich wie weit manche von der Realität in Schulen entfernt sind.
Schulen besonders in Städten haben ganz andere Probleme, da rate ich mal zur Recherche.
Grüße
Thomas
Die Methoden der offenen Lernformen und Lernmethoden /offene Klassenzimmer haben einen Effekt von 0,01 laut Metaanalysen.
https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/
Ich wäre zunächst mal daran interessiert, dass Schulen
durch ein Ende der Arbeitszeit-Entgrenzung
ein Gefühl der Leichtigkeit schaffen.
“Im Lernbüro herrscht Stille, da hier konzentriert gearbeitet wird. Wer reden und sich austauschen möchte, darf das, nur eben nicht im Lernbüro, sondern im Marktplatz-Raum.”
Meine Erfahrung steht dem entgegen. So ungefähr 15 Mal am Tag äußere ich den Satz “Zum Toben, brüllen oder schnattern geht ihr da und da hin. Hier nicht.”
Das dürfen sie auch. Tun sie aber nicht, jedenfalls nicht ohne Nachdruck. Entscheidend ist da weniger der Raum sondern die soziale, personelle Konstellation. Es reicht auch völlig wenn einer von fünf sich nicht an die Regeln hält. Letztendlich müssen solche Räume wieder permanent überwacht und die Regeln durchgesetzt werden.
Und dann hat wieder jeder, Kinder oder Nichtkinder, eine andere Vorstellung von Ruhe oder Arbeitsatmosphäre.
Beschwerden und Gezeter sind da von allen Seiten vorprogrammiert.
Hilfreicher ist es dann diesbezüglich schon mehr, wenn man grundsätzlich den “Raum” öffnet. Die Kinder finden dann schon ihre Rückzugsorte. Aber dann kommen dann wieder die Aufsichtspflicht oder irgendwelche Eltern, die das so gar nicht verstehen oder organisatorische Dinge.
Ach komm schon … da gibt es doch bestimmt jemanden da draußen, der jetzt den weisen Satz raushaut: “Das muss ja auch kleinteilig eingeübt werden, damit das klappt!”
Habt euch nicht so … ihr könnt diesen Satz doch bestimmt auch sagen / schreiben. 😉
Klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Wer kennt nicht noch die Gruppenarbeit von früher? Einer hat sie gemacht, die anderen sprachen über Fußball oder die Planungen zum Wochenende. Der Bericht geht mir viel zu sehr von komplett intrinsisch motivierten Kindern aus, die nie stören und obendrein lern- und arbeitswillig sind. Es kommt im Garten Edens auch zu keinen Raufereien, Streitereien, Prügeleien und es werden keine Schindluder mit den Tablets getrieben. Ergo: Das Wunder der Bildung liegt in den beschriebenen, offenen Lernformen… Oder doch nicht?
Auf mich wirken solche Einlassungen immer wie der letzte verbliebene Rettungsanker, den man noch hat: Das System komplett umkrempeln, weil einfach keine anderen Ideen mehr vorhanden sind. Man hofft, dass es läuft, wie an den Modellschulen. Ein paar Coaching-Gespräche mit den “Lernbegleitern” sollen es richten. Die Pubertät wird als möglicher Störfaktor nicht mehr benannt. Alle Kinder aller Jahrgänge wollen nur eines: Wissbegierig eigenständig und selbstorganisiert lernen, sobald man alle traditionellen Schulhüllen fallen lässt. Entweder ist diese Vorstellung extrem naiv oder am Ende doch das Ei des Kolumbus. All meine Erfahrungen mit meinen eigenen Kindern, mit Kindern und Familien in unserer Betreuung und mit verschiedensten Schulen im Kreis, sagen mir jedoch das Gegenteil.
Ich finde auch, dass selbstbestimmte (selbstorganisierte) Lernformen auf idealisierten Vorstellungen vom Wesen des Kindes basieren. Keine Lernform kann aber funktionieren, wenn die zugrunde liegenden Annahmen nicht stimmen.
Danke!!
Pisa-Absturz von Finnland
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/finnland-was-ist-fuer-den-pisa-absturz-verantwortlich/
Wie passt das jetzt zu Hatties Aussagen der Überindividualisierung…