BONN. Fünf Jahre lang haben sie diskutiert, gestritten, abgestimmt – nun mündet die Arbeit der über 700 Mitglieder des Bürgerrats Bildung und Lernen am 21. und 22. November in eine große Abschlusskonferenz in Berlin. Im Mittelpunkt stehen die Empfehlungen des Bürgerrats für eine gerechte, zukunftsorientierte Bildung: von der Abschaffung der Hausaufgaben bis zu mehr Demokratiebildung. Doch was genau steckt hinter diesen Vorschlägen? Wie sind sie eigentlich entstanden und wie blickt der Bürgerrat auf die Zukunft? Antworten darauf bieten zwei, die es wissen müssen: In dieser Folge des Bürgerrats-Podcasts „Bildung, bitte!“ sprechen Bürgerratsmitglieder Kübra Dikbaş und Florian Daumüller mit Moderator Andreas Bursche über Weg, Ergebnis und Ziel der Bürgerratsarbeit.

Mehr als 700 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger – darunter auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren – haben seit 2021 gemeinsam im Bürgerrat Bildung und Lernen Verbesserungsvorschläge erarbeitet – für die Schule, aber auch das gesamte Bildungssystem in Deutschland. Und die Empfehlungen haben es in sich: mehr Freiheit beim Lernen, individuelle Rückmeldungen statt Ziffernnoten und Vertiefungsstunden anstelle klassischer Hausaufgaben. In Folge 11 von „Bildung, bitte!“ sprechen zwei Mitglieder des Bürgerrats darüber, wie diese Vorschläge entstanden sind, wo es im Meinungsbildungsprozess gerieben hat und was sich nun ganz konkret ändern müsste.
„Wir wollen, dass die Politik sich Gedanken macht“
Zu Gast sind Kübra Dikbaş, Erzieherin in der Jugendhilfe und ehemalige Kita-Erzieherin, sowie Florian Daumüller, Kommunikations- und Soft-Skills-Trainer für Unternehmen. Beide zeigen sich begeistert von der Arbeit im Bürgerrat und hoffen, dass ihre veröffentlichten Empfehlungen Veränderungsprozesse anstoßen werden. „Wir sind jetzt nicht zufrieden damit, nur etwa auf Papier gebracht zu haben. Es geht darum, dass die Dinge umgesetzt werden, dass darüber diskutiert wird“, sagt Daumüller. Der Bürgerrat wolle keine fertigen Rezepte liefern, sondern Denkanstöße geben. „Uns ist gar nicht so wichtig, dass alles eins zu eins übernommen wird, aber wir wollen, dass die Politik sich Gedanken macht – und ernst nimmt, was Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Themen sagen.“
Da wäre etwa das Thema „Freiheit beim Lernen“: Der Bürgerrat plädiert dafür, dass Schüler*innen, die Lerninhalte mitgestalten können. Kübra Dikbaş beschreibt, was sie darunter versteht: „Lerninhalte selbst wählen heißt für mich, dass man zum Beispiel im Kunstunterricht selbst bestimmen kann, welchen Künstler man bespricht und welche Techniken man kennenlernt.“ Das Ziel sei allerdings nicht, Bildung antiautoritär zu gestalten, betont Daumüller. „Aber gutes Lernen funktioniert dort, wo Entscheidungen möglich sind, wo Freiheiten sind.“ Entscheidend sei die Balance zwischen Selbstbestimmung und Struktur. „Man muss schauen, wo man Leitplanken weglassen kann und wo sie nötig sind.“ Lernen gelinge besser, wenn sich Kinder für Inhalte interessieren – und Lehrkräfte könnten Kompetenzen gezielt an diesen Interessen ausrichten.
Wichtig: unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen
Dikbaş erinnert sich an intensive Diskussionen zum Thema Freiheit – etwa während einer Sitzung in Leipzig. „Da kamen sehr unterschiedliche Meinungen zusammen.“ Besonders in ihrer Arbeitsgruppe zur frühkindlichen Bildung sei es teils hitzig zugegangen. Für sie beginne freies Lernen schon in der Kita – das hätten jedoch nicht alle so gesehen. „Da kam direkt Gegenwind.“ Daumüller bestätigt, dass die Debatte von unterschiedlichen Sichtweisen geprägt war – weniger von Generationenunterschieden als von unterschiedlichen Erfahrungen. „Manche denken einfach drei, vier Schritte weiter und sehen Probleme, die andere noch nicht sehen.“ Wichtig sei, diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen.
Kontrovers diskutiert wurde auch der Vorschlag, dass Schülerinnen und Schüler sich prüfen lassen dürfen, wenn sie sich bereit fühlen. Unter den jüngeren Bürgerratsmitgliedern fand diese Idee große Zustimmung, bei den Erwachsenen stieß sie dagegen mehrheitlich auf Skepsis. „Vielleicht ist es eher ein Erfahrungskonflikt als ein Generationenkonflikt“, sagt Daumüller. Erwachsene hätten erlebt, wie schwer es sei, sich selbst Fristen zu setzen – und befürchteten, Prüfungen könnten sich endlos verschieben. „Ich wäre wahrscheinlich auch so ein Kandidat gewesen.“ Dennoch hält er es für wichtig, Jugendlichen zuzuhören: „Bürgerrat-Style heißt hier, man müsste mit den Jugendlichen nochmal reden, warum sie das für sinnvoll halten.“
Auch Dikbaş betont, dass bei Prüfungen ein zeitlicher Rahmen nötig sei: „Man kann ja schlecht sechs Jahre bis zum Abi brauchen.“ Prüfungen sollten daher flexibel, aber nicht beliebig sein. „Man kann die Prüfungen nach dem eigenen Lerntempo legen, aber innerhalb eines festgelegten Rahmens.“
Empfehlungen: Ziffernnoten erst ab der 9. Klasse, Hausaufgaben abschaffen
Auch beim Thema Bewertung zeigt sich der Bürgerrat mutig: Die Mehrheit empfiehlt, Ziffernnoten bis zur neunten Klasse abzuschaffen und stattdessen individuelle Lernfeedbacks einzuführen. Erst danach sollen Noten ergänzend hinzukommen. Darüber hinaus sollen klassische Hausaufgaben entfallen – ersetzt durch Vertiefungsstunden im Schulalltag.
Kübra Dikbaş befürwortet diesen Vorschlag ausdrücklich. „Vertiefungsstunden sind eingeplante Zeit im Stundenplan, damit man nicht nach der Schule noch Hausaufgaben machen muss“, erklärt sie. Das entlaste nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Eltern. „Wenn ich an meine Schulzeit denke, war ich oft erst um 16.30 Uhr, 17 Uhr zu Hause. Danach noch Hausaufgaben – das war schon ein Fulltimejob.“ Vertiefungsstunden könnten dazu beitragen, Schule und Freizeit wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Für Florian Daumüller sind solche Veränderungen kein Selbstläufer – sie erforderten mehr Zeit und Personal, aber vor allem ein anderes Denken. „Zu sagen, wir lassen Schüler alles selbst entscheiden und brauchen dann nur noch einen Hausmeister – das wird nicht funktionieren“, sagt er. „Es ist eher zeit- und personalintensiver. Aber es lohnt sich, weil es ein neues System ist, das Verantwortung anders verteilt.“
„Es gibt Schulen, die schon heute selbst etwas umsetzen könnten.“
Ein weiteres Thema, das beiden wichtig ist, betrifft die berufliche Bildung. Der Bürgerrat empfiehlt, flächendeckend Berufsorientierungswochen einzuführen, um allen Jugendlichen realistische Einblicke in verschiedene Berufe zu ermöglichen. „Es gibt zwar viele Ansätze, aber die Qualität ist sehr unterschiedlich. Manche Schulen machen das wunderbar, andere sehr kurz oder zum falschen Zeitpunkt“, so Daumüller. Er wünscht sich, dass Jugendliche rechtzeitig Orientierung bekommen und Unternehmen ernsthafte Praktikumserfahrungen bieten.
Dikbaş pflichtet ihm bei, gibt aber zu bedenken, dass Lehrkräfte allein diese Aufgabe nicht stemmen könnten. „Lehrer sind ja nicht in allem ausgebildet“, sagt sie. „Deshalb braucht es Menschen aus der Praxis. Wenn jemand aus dem Beruf erzählt, catcht das Jugendliche ganz anders.“ Sie plädiert dafür, solche Begegnungen früher zu ermöglichen, damit junge Menschen ihre Stärken entdecken können.
Am Ende richtet sich der Blick nach vorn. „Freiheit beim Lernen betrifft viele Ebenen. Es gibt Schulen, die schon heute selbst etwas umsetzen könnten, ohne dafür auf ein Kultusministerium warten zu müssen. Andere Themen liegen auf kommunaler oder Landesebene, manches muss bundesweit geklärt werden. An all diesen Stellen gibt es aber Menschen, die Veränderungen anstoßen könnten – und genau diese wollen wir erreichen“, sagt Daumüller. Dikbaş und Daumüller wünschen sich, dass die Empfehlungen als Impuls verstanden werden. Beide hoffen, dass die Politik ihnen zuhört, aber auch, dass Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen den Mut finden, Neues auszuprobieren. News4teachers
Der Bürgerrat Bildung und Lernen besteht aus mehr als 700 zufällig ausgelosten Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland und wurde 2020 von der Montag Stiftung Denkwerkstatt ins Leben gerufen. Sie hat auch den vorliegenden Podcast bereitgestellt.
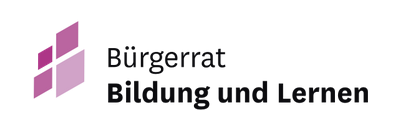
Im Sinne einer lebendigen Demokratie diskutieren die Mitglieder des Bürgerrats gemeinsam über gesellschaftliche und bildungspolitische Fragen. Welche Probleme und Herausforderungen müssen im Bildungsbereich dringend bearbeitet werden? Wie könnten bildungspolitische Reformen aussehen, die Probleme lösen und gleichzeitig in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind? Und: Wie soll gerechte Bildung in Zukunft aussehen?
Ein umfassendes Papier mit Empfehlungen wurde unlängst erarbeitet (News4teachers berichtete). Leitthema dabei: „Chancengerechtigkeit: Wie viel Freiheit braucht das Lernen?“
Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist aktuell der einzige Bürgerrat, der auf Bundesebene aktiv ist und auch Kinder und Jugendliche einbezieht. Die mehr als 250 Schülerinnen und Schüler kommen über sogenannte Schulwerkstätten der Bundesländer dazu und sind vollwertige Mitglieder des Bürgerrats Bildung Lernen. Darüber hinaus haben sie aber auch eigene Empfehlungen entwickelt sowie einen offenen Brief unter dem Titel „Hört und zu!“ geschrieben.
Hier geht es zu weiteren Folgen der News4teachers-Podcasts:
Den Podcast finden Sie auch auf









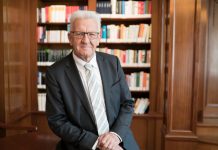








Wie üblich ganz viel Pathos und Forderung mit wenig Verankerung in der Realität. Nehmen wir das Beispiel der Berufsorientierung. Natürlich ist es gewinnbringend, wenn Berufstätige in Schulen von ihrem Alltag erzählen. Dieses Vorhaben müsste jedoch nicht nur ein absolut breites Spektrum an Berufen abdecken, es müssten viele Schulen im Laufe eines Schuljahres bedient werden, es braucht die Zeit und den Raum dafür und zusätzlich muss es sich eine Firma leisten können, ständig Mitarbeiter dafür zu entsenden.
Es gibt bereits Ausbildungsmessen und -tage an diversen Schulen in unserem Einzugsgebiet, aber diese bilden nicht jenen Umfang ab, der hier gefordert wird.
Generell gehen die Forderungen nach Systemen, die in Gänze zeit- und personalintensiver (und somit kostenintensiver) sind, völlig an der aktuellen Realität vorbei: Klamme Kommunen und zu wenig Fachkräfte sind ein Problem. Aber wie üblich gilt: Fordern können wir es ja mal.
Wenn man die ganzen Gymnasien wieder zu dem macht, was sie eigentlich sein sollten, könnte man die schon einmal weglassen und im gleichen Atemzug die dualen Studiengänge wieder einstampfen, weil dann die mittleren Schulformen genug fähige Azubis in die Arbeitswelt entlassen. Die Sache mit den minderjährigen Azubis war in früheren Zeiten auch kein Problem.
“Fordern können wir es ja mal.”
Bei realistischen (!!!) Forderungen bin ich seit Jahren der Meinung:
Wer nix fordert, kriegt auch nix! Gern auch etwas überzogen, damit auch “was” als Ergebnis rüber kommt!
Als Personalrat bin ich damit jahrelang gut gefahren!