KÖLN. Die Bilanz ist ernüchternd: Deutschlands Schulen verlieren weiter an Qualität. Das zeigt der neue Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für 2025. Erste Ergebnisse wurden vorab der Welt am Sonntag und dem ARD-Hauptstadtstudio bekannt – die vollständige Studie soll erst in zwei Wochen veröffentlicht werden. „Die Lage an Deutschlands Schulen bleibt schlecht. Sie hat sich gegenüber 2024 weiter leicht verschlechtert“, konstatiert Axel Plünnecke, der am IW das Cluster Bildung, Innovation, Migration leitet.

Die Zahlen sprechen für sich – und sie wirken dramatisch: Der Bildungsmonitor setzt beim ersten Erscheinungsjahr 2013 den Wert 100 als Referenz. Und nun liegt der Wert für Integration und Bildungschancen nun 43,7 Punkte niedriger. Bei der Schulqualität beträgt der Verlust 28,2 Punkte, bei der von den Kindern mitgebrachten Bildungsarmut 26 Punkte. Besonders gravierend ist die Lage bei Kindern aus Flüchtlingsfamilien, die das Schulsystem vielerorts vor kaum lösbare Aufgaben stellt.
Doch das ist nicht alles. Laut Plünnecke haben die Schulen auch die Folgen der Pandemie nicht ausreichend verarbeitet: Lernrückstände, Motivationsprobleme und eine wachsende Überforderung im Umgang mit digitalen Reizen. „Die permanente Nutzung von Smartphones führt oft zu Konzentrationsproblemen. Kinder können Erlerntes nicht ausreichend verarbeiten“, so der Bildungsforscher im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Am stärksten betroffen seien Kinder aus bildungsfernen Schichten – sie drohten endgültig abgehängt zu werden.
Plünnecke: „2015 war die Wasserscheide“
Der Bildungsökonom beschreibt eine klare Trendwende: „Bis 2015 sind die Schulen besser geworden, danach schlechter.“ Der Grund: die hohe Zuwanderung von Flüchtlingskindern, auf die das Schulsystem nicht vorbereitet war. „Mehr Kinder sind an sich ein Gewinn für das Land“, erklärt Plünnecke gegenüber der Welt am Sonntag. „Aber 2015 hat das Schulsystem überfordert, man fand keine schnellen Antworten auf die Herausforderungen der gestiegenen Fluchtmigration.“
Seine Diagnose ist eindeutig: Noch immer reagiere die Bildungspolitik zu spät. „Heute haben die Kinder in 30 bis 40 Prozent unserer Schulen große Defizite. Viele erreichen etwa beim Lesen die Mindeststandards nicht.“ Abhilfe sieht Plünnecke in verbindlichen Sprachtests, in einer massiven Ausweitung von Sprachförderung bereits in den Kitas und in Programmen, die die „digitale Mündigkeit“ stärken. Zudem brauche es eine deutliche Ausweitung des Startchancenprogramms, das sozial benachteiligte Schulen stützen soll.
Ministerin Prien verweist auf Koalitionsvertrag – Union fordert Sanktionen
Die Politik reagierte prompt auf die alarmierenden Ergebnisse. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) verweist auf Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben sind: „Wir haben eine flächendeckende, verpflichtende Sprach- und Entwicklungsdiagnostik für vierjährige Kinder vereinbart“, sagte sie der Welt am Sonntag. Nur wer Förderbedarf früh erkenne, könne gezielt helfen. „Eltern spielen dabei eine Schlüsselrolle.“ Es gehe darum, Chancen zu eröffnen, nicht zu bestrafen. Doch Prien fügte auch an: „Wenn Kinder Hilfe brauchen und Unterstützung dauerhaft ausbleibt, müssen wir gemeinsam Lösungen finden.“
Ihre Parteikollegin Anne König, bildungspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, geht weiter. Sie regte an, „im Zweifel auch über wirksame Sanktionen nachzudenken“. Voraussetzung wäre allerdings, dass allen Kindern eine bedarfsgerechte Sprachförderung angeboten wird – was nachweislich nicht der Fall ist, wie unlängst erst die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK feststellte (News4teachers berichtete).
SPD, Grüne, Linke – unterschiedliche Akzente, gleiche Sorge
Auch die übrigen Parteien meldeten sich zu Wort. SPD-Bildungspolitikerin Jasmina Hostert unterstützt die Forderung nach verbindlichen Sprachtests. Sie könnten helfen, „individuelle Förderbedarfe frühzeitig festzustellen“. Fördermaßnahmen müssten dann allerdings auch verpflichtend sein.
Die Linke hingegen setzt auf eine Investitionsoffensive in frühkindliche Bildung. Nicole Gohlke sagte: „Es braucht eine große Ausbildungsoffensive und mehr Investitionen in Bildung, statt Erzieherinnen noch mehr Aufgaben aufzubürden.“
Die Grünen betonen die Notwendigkeit bundesweiter Standards. „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, erklärte die bildungspolitische Sprecherin Anja Reinalter. Verbindliche Tests seien sinnvoll, Sanktionen für Eltern jedoch kontraproduktiv: „Es geht darum, Eltern mitzunehmen, zu überzeugen und gemeinsam das Beste für ihre Kinder zu erreichen.“
Die Wissenschaft verweist auf die Bedeutung frühkindlicher Bildung. Prof. Havva Engin von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg stellte klar: „Entscheidend für Bildungserfolg ist nicht erst die Schule, sondern die Zeit davor. Die Bildungskarriere eines Kindes wird im Kindergarten gemacht. Versäumte Förderung verursacht enorme Folgekosten. Prävention ist günstiger als lebenslange Reparatur.“
Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), zieht angesichts des Personalmangels in den Schulen ein düsteres Fazit: „Wir können die aktuellen Schülerzahlen mit originär ausgebildeten Lehrkräften schon gar nicht mehr abdecken. Heute tragen Kinder oft die elterlichen Probleme in die Schule. Und die Lehrkraft soll’s richten.“ Seine Forderungen: kleinere Klassen, bessere Ausbildung von Quereinsteigern und mehr gesellschaftliche Unterstützung. „Schule kann aber nicht alles richten. Eltern, Kommunen und Vereine müssen ihren Beitrag leisten. Es braucht ein gemeinsames Verständnis von Bildung als Lebenschance.“ News4teachers / mit Material der dpa


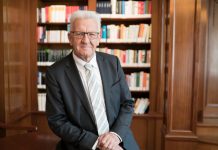








Rein statistisch wäre das Kriterium zunehmender Migration nicht so ganz eindeutig mit stark sinkenden Leistungen verknüpft.
Wenn man z.B. beim Bildungsmonitor 2024 die Liste der Bundesländer betrachtet, die in den letzten 10 Jahren beim Kriterium Schulqualität am meisten Punkte verloren haben, fällt schon auf, dass das überwiegend Bundesländer mit vergleichsweise niedrigem Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind.
Auch bei PISA 2022-Lesen haben Länder wie Finnland oder die Niederlande im Vergleich zu 2015 deutlich mehr Punkte verloren als DE, obwohl auch dort der Anteil Zuwanderer wesentlich geringer wäre.
Es kommt auch auf die Art des Migrationshintergrundes an. Und Zuwanderer sind ganz anders aufgestellt als Flüchtlinge aus bildungsfernen Ländern, die aber auch in die Schulen integriert werden müssen.
Wen genau meinen Sie mit “Zuwanderer”, die ganz anders aufgestellt sein sollen – was sind “bildungsferne Länder”? Hier die Liste der Zugewanderten nach Herkunftsländern: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157446/umfrage/hauptherkunftslaender-der-zuwanderer-nach-deutschland-2009/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich mache den notwendigen Unterschied zwischen Migranten und Asylsuchenden, denn nach wie vor qir alles in einen Topf geworfen.
Die Migranten, die Ihnen gefallen (würden), kommen aber leider nicht nach Deutschland – zu unattraktiv.
“Auch unser Alltag würde sich ohne einen deutlichen Anstieg der Zuwanderung – gerade auch von geringer qualifizierten Menschen – zum Teil dramatisch verschlechtern. Viele dieser Migrantinnen und Migranten, darunter auch Geflüchtete, arbeiten in systemrelevanten Berufen. Ohne sie funktioniert weder Pflege noch Gesundheitsversorgung, weder Landwirtschaft noch Supermarktlogistik, weder Haushaltsdienstleistungen noch Reise- und Gastgewerbe.
Das hätte nicht nur spürbare Auswirkungen auf das tägliche Leben jedes einzelnen Deutschen, sondern auch gravierende wirtschaftliche Folgen. Denn selbst bei niedrigem Einkommen zahlen Migrantinnen und Migranten Steuern und Abgaben. Und ohne ihre Arbeit könnten viele Deutsche gar nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig sein – weil sie stattdessen Angehörige pflegen oder Kinder betreuen müssten.” Gerne hier nachlesen: https://www.zeit.de/wirtschaft/2025-06/kosten-migration-integration-sozialleistung-finanzen-nutzen/seite-2
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Mit Satz 1 haben Sie zwar Recht, aber ich glaube nicht, dass die Bundesländer großen Einfluss auf die Herkunft der zugewiesenen Asylbewerber haben Wenn meine Informationen stimmen, werden Asylbewerber nach dem Königsteiner-Schlüssel auf die Bundesländer verteilt.
Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass unter den von 3% auf 7% gestiegenen Prozentanteilen in Finnland und den von 11% auf 14% in NL so wesentlich mehr Geflüchtete aus bildungsfernen Schichten gewesen sein sollen als bei den von 13% auf 26% in DE.
Die zweitgrößte Gruppe von Zugewanderten Menschen in Deutschland waren 2024 rumänische Staatsangehörige.
Das sind ja keine Geflüchteten, sondern EU-Staatsangehörige.
Allerdings kann ich aus den Erfahrungen an meiner Schule berichten, dass es sich bei den an unserer Schule unterrichteten Kids bis auf eine Ausnahme (Der junge Mann hat dieses Jahr ein gutes Abitur gemacht.) um solche aus bildungsfernen Familien handelt. Leider ist es sehr schwierig, diese Kids zu unterstützen, da die Familien nicht mitspielen.
Das Problem ist klar: fehlende Vorbereitung, zu spätes Handeln und zu wenig Personal.
Frühe Sprachförderung, kleinere Klassen und gesellschaftliche Unterstützung sind dringend nötig. Reden allein reicht nicht.
Die Lösung könnte ganz einfach sein: ein soziales Pflichtjahr für Boomer. Alle BoomerRentner in die Schule stecken. Problem gelöst!
Was haben Sie denn geraucht!
Im Leben nicht würde ich mich mit bildungsfernen Schülern und deren Familien abgeben wollen… womöglich gewaltbereit und nicht integrierbar. Ich hoffe sehr für Sie, dass Sie im Nachgang noch einmal überlegen, was für einen Blödsinn fordern.
“Wenn Kinder Hilfe brauchen und Unterstützung dauerhaft ausbleibt, müssen wir gemeinsam Lösungen finden.”
Blieb sie! Welche Sanktionen sind gegen die Bildungspolitiker*innen vorgesehen?
“Auf Migration nicht eingestellt – Deutschlands Schulen rutschen weiter ab” – wir haben durchaus ein massiv arbeitsintensives Förderprogramm aufgebaut. Allerdings gibt es sehr wohl Änderungen in der Zusammensetzung der Heranwachsenden, die seit knapp 2019/2020 dieses oft ins Leere laufen lässt. Die Bildungsvoraussetzungen sind oft nicht gegeben, Kinder mit 14 kommen in Sprachklassen ohne alphabetisiert zu sein und die Aufgabe soll sein, diese mit 17 zum Hauptschulabschluss zu führen.
Scheint aber in den 16 Bundesländern unterschiedlich gut zu gelingen. Es gab z.B. vor kurzem eine Studie der MLU-Halle, dass geflüchtete Jugendliche bei gleichen individuellen Voraussetzungen in verschiedenen Bundesländern signifikant unterschiedliche Sprachkompetenzen in Deutsch aufwiesen.
Der Eingangssatz „Deutschlands Schulen verlieren weiter an Qualität” schmerzt.
Möglicherweise ist er nötig, um die journalistisch notwendige Zuspitzung zu erreichen.
Mir greift diese Diagnose zu kurz. Sie wird nicht gerecht, was täglich in den Klassenzimmern passiert. Die Kolleginnen und Kollegen leisten unter immer schwierigeren Bedingungen Außergewöhnliches. Ihr Ringen um jedes einzelne Kind – das hatte und hat hohe Qualität.
Was sinkt, sind die messbaren Erfolge, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr passen.
Die Schulen sind nicht das Problem. Sie sind der Ort, wo sich die Versäumnisse von Politik und Gesellschaft zeigen.
Es muss sich etwas ändern – und das weiß auch eigentlich jeder seit vielen Jahren, leider passiert sehr wenig.
Migration ist Realität in Deutschland. Das heißt auch: Immer mehr Kinder kommen in unsere Klassen, die zu Hause wenig Unterstützung bekommen – wobei das nicht nur an der Migration liegt, sich damit aber verschärft hat.
Bereits die Sprachförderung ist eine Mammutaufgabe. Deshalb ein “Ja” zu verbindlichen Sprachtests und Fördermaßnahmen. Aber „verbindlich” ohne Konsequenzen ist wirkungslos.
Die Schulen brauchen klare Strukturen:
* Leistungsansprüche, die durchgesetzt werden können
* Verlässliche Elternarbeit – mit Folgen bei Verweigerung z.B. bei der Schulpflicht
* Klares Verhaltensmanagement
* Zusätzliche Hilfe für Kinder aus schwierigen Verhältnissen
* Genug Personal für individuelle Förderung
* Räume und Ausstattung, die zeitgemäß sind
* Unterstützung durch Schulsozialarbeit und Psychologen
Und das ist nur ein Ausschnitt dessen, was nötig wäre.
Die Verantwortung liegt bei einer Bildungspolitik, die die notwendigen Ressourcen bereitstellt, um die großen Aufgaben zu bewältigen. Insofern können die notorisch gleichen Aussagen der verschiedenen Parteien nur verwundern, wäre es doch ihre Aufgabe, diese Änderungen zu bewirken.
Ich würde sagen: Die Verantwortung liegt zwar nicht allein, doch überwiegend an einer illusorischen Migrationspolitik, die über die Asylschiene für viel zu viele bildungsferne Einwanderer gesorgt hat, deren Kinder gar nicht so schnell und so reibungslos intergriert werden können, wie nötig wäre. Ohne ausreichende Integration gerät jede Gesellschaft und mit ihr das Bildungssystem jedoch in eine gefährliche Schieflage, die alle in Mitleidenschaft zieht. Was Sie alles an Forderungen aufstellen, klingt schön, ist aber märchenhaft.
Sic! Selbst bei märchenhaften Bedingungen kann die Müllerstochter trotzdem nicht aus Stroh Gold spinnen.
Trotzdem scheint mir die These, dass der gestiegene Migrationsanteil praktisch allein für die sinkenden Leistungen seit 2015 verantwortlich sein soll, nicht so ganz schlüssig sein.
Gibt ja z.B. Bundesländer mit relativ niedrigem Anteil , wo es aber deutlicher bergab ging als in Bundesländern wo der Anteil bis zu doppelt oder dreimal so hoch war.
Ähnlich auch bei PISA im Vergleich DE zu anderen EU-Ländern.
Da dürften neben der Migration vermutlich auch noch andere Kriterien eine Rolle spielen.
@ed840
Sie haben geschrieben:
“Da dürften neben der Migration vermutlich auch noch andere Kriterien eine Rolle spielen.”
Es gibt auf jeden Fall einen Faktor, der sehr eindeutig eine Rolle spielt – das ist die Verwendung von Smartphones. Die hat in diesem Zeitraum deutlich zugenommen. Studien (z. B. Twenge et al., 2017) zeigen eine klare Korrelation zwischen starker Handynutzung und Konzentrationsproblemen, Schlafmangel sowie psychosozialen Belastungen.
Dann gab es die Schulschließungen und die kollektive Belastung durch Corona – mit dokumentierten Lernrückständen, insbesondere bei benachteiligten Lernenden.
Als weiteren Punkt sehe ich die zunehmende Durchdringung der Lehrpläne mit Kompetenzen. Dass wissensbasierte Lehrpläne gegenüber rein kompetenzorientierten überlegen sind, ist durch internationale Vergleiche gut belegt – etwa im Unterschied zwischen der englischen und der walisischen Bildungspolitik (vgl. Tim Oates, 2014).
Man könnte noch anführen, dass es in Deutschland – genauer natürlich in den Bundesländern – keine flächendeckend evidenzbasierte, sondern oft ideologisch motivierte Unterrichtsentwicklung und Bildungspolitik gibt. Das ist kein Geheimnis, sondern wird seit Jahren von der Bildungsforschung kritisiert. Allerdings ist das kein neuer Faktor seit 2015. Dass sich deutsche Bildungspolitik weiterhin weigert, flächendeckend evidenzbasierte Unterrichtsmethoden und ein verlässliches Verhaltensmanagement einzuführen, ist schwer nachvollziehbar – und angesichts der Konsequenzen unverantwortlich.
Das hochgelobte und auch auf dieser Plattform regelmäßig herbeigeschriebene „selbstgesteuerte Lernen“ mit der Lehrkraft als „Lernbegleiter“ ist bislang vor allem anekdotisch positiv belegt – aber kaum durch robuste empirische Evidenz gestützt. Ganz im Gegenteil: Die Metastudie „Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work“ von Kirschner, Sweller und Clark (2006) argumentiert klar gegen minimal gesteuerte Lernformen. Auch Hattie zeigt mit einer Effektstärke von rund 0,6 für direkte Instruktion im Vergleich zu nur 0,02 für „Student control over learning“, wie eklatant die Unterschiede sind.
Selbstgesteuertes Lernen kann durchaus für begabte Lernende und/oder solche aus fördernden Elternhäusern funktionieren – so zeigt z. B. eine Studie von Ravi & Leddo (2017), dass bei „gifted and talented“ Lernenden kaum Leistungsunterschiede zwischen selbstgesteuertem und lehrergeleitetem Lernen bestehen. Das Problem ist nur: Die Mehrheit der Kinder – zumindest an den Schulen, an denen ich in den letzten (nun ja, vielen) Jahren gearbeitet habe – gehört nicht zu diesen privilegierten Gruppen.
Dennoch werden alle mit denselben ungeeigneten Methoden konfrontiert – nicht, weil sie funktionieren, sondern weil die Bildungspolitik evidenzbasierte Unterrichtsmodelle systematisch ignoriert oder abwertet. Das hat nichts mit Fortschritt zu tun, sondern mit einer gefährlichen Realitätsverweigerung.
Ich kann Ihre Argumente gut nachvollziehen.
Dass Bildungspolitiker schlechte Kennzahlen meist reflexartig mit Migration in Verbindung bringen und andere Faktoren unerwähnt lassen, bleibt mir deshalb etwas suspekt.
Dazu kommen noch mehr SOL, Schreiben nach Gehör, Inklusion und negativer Flynn-Effekt.
Und Frau Merkel hat bei ihrem Satz das “Jo,..” vergessen, deshalb klappt nicht!
Da finde ich es fast ironisch, dass zeitgleich Forderungen lauter werden, Hausaufgaben, Noten und Sitzenbleiben abzuschaffen. Man möchte dem Leistungsverfall also mit weniger Anforderungen begegnen und erhofft sich dadurch Lösungen.
Man liest zudem nur, man müsse mehr fördern, fördern, fördern. Dazu bedarf es aber auch dem Willen des Empfängers, sich fördern zu lassen. Das geht oft nur durch das Fordern. Ich zähle dazu verpflichtende Deutschkurse für Eltern, die die Sprache nicht beherrschen. Es kann nicht sein, dass Menschen seit über zehn Jahren hier leben und keinen Brocken Deutsch können. Solche Fälle begegnen uns immer wieder. Hier fehlt es schlicht am Willen und dem fehlenden Druck.
In den letzten 10 Jahren hatten wir verstärktfolgende zusätzliche Aufgaben (neben der Vermittlung von Lerninhalten lt. Bildungsplan) zu leisten:
Diese Punkte sind mir spontan eingefallen, bei weiterem Nachdenken würde die Liste sicher doppelt so lang…
Wer wundert sich da noch, dass der Schulerfolg immer geringer wird? Wann werden endlich in der Erziehungspartnerschaft auch Dinge von Eltern eingefordert? Es kann einfach nicht sein, dass sämtliche Probleme ausschließlich in der Schule gelöst werden müssen!
Sie haben das Verbot der Prügelstrafe vergessen.
Zu der Zeit, als es diese noch gab, war doch alles besser, wenn man den entsprechenden Foristen hier glauben darf.
Die meisten hier im Forum Schreibenden dürften wohl kaum noch die Prügelstrafe in Schulen miterlebt haben.
Es ist auch kaum anzunehmen, dass die, die die Prügelstrafe nicht miterlebt haben, diese befürworten.
Inwiefern ihr ironisch gemeinter Kommentar zu der Liste an Aufgaben von Schule passen soll, erschließt sich mir nicht. Bieten Sie doch lieber mal eine Lösung an, die im besten Falle kein zusätzliches Personal (da nicht vorhanden) erfordert.
Dieser Kommentar erschließt sich mir nicht. Wieso sollte Jette bei den von ihr sehr zu recht aufgeführten Punkten ein Verbot der Prügelstrafe vergessen haben? Dieses hat aber auch nichts mit den aufgeführten Punkten gemein. Und welcher Forist hier hat jemals geäußert, früher – zur Zeit der Prügelstrafe – sei alles besser gewesen?
Schiefe Beispiele, polemische Unterstellungen und Nebelkerzen…
Den Untergebenen mit so vielen Aufgaben überhäufen, dass er sie unmöglich schaffen kann, ihm obendrein Arbeitsmittel in angemessener Form, Qualität und Menge verweigern — und ihm dann seine mangelnde Leistung vorhalten.
Genau mein Humor.
In der freien Wirtschaft wird sowas als Mobbing gewertet. Just saying.
Interessant finde ich dabei auch, dass das Leistungsniveau all die Jahre sinkt, obwohl all die Jahre versucht wird, “von oben” Unterricht spaßiger, spannender, lustiger zu machen. Stupides Üben ist verpönt. Störungen soll man bitteschön freundlich-gelassen ertragen. Und außer Unterricht soll man auch noch dies und das und jenes machen. Ergebnis: Leistungsniveau sinkt. Und die Kinder gehen trotzdem nicht “gerner” zur Schule als früher.
Später Sieg der AfD: Deutsche Schulen (auf n4t) zeigen die Flagge 😛
Bei all den Fördermaßnahmen, die im Bildungswesen mit Bezug auf Intergration in der Tat gestemmt werden (Ja, das finde ich wirklich!) , finde ich es sehr vermessen, zu behaupten, Deutschland sei auf Migration einfach generell nicht eingestellt.
Ich glaube vielmehr, die Ausmaße der Immigration und besonders auch die spezifischen Charakteristika sehr großer Anteile der Migranten sind es, die das ganze – auch bei maximaler Anstrengung – nicht mehr stemmbar machen.
“Bei all den Fördermaßnahmen…”
Welchen denn? Nicht mal die basalste – Sprachförderung – ist obligatorisch in Deutschland, wie unlängst auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK festgestellt hat. So sieht das dann in der Praxis aus: https://www.news4teachers.de/2024/06/brennpunkt-graefenauschule-wo-praktisch-jedes-schulkind-einen-migrationshintergrund-hat-aber-die-mittel-fuer-besondere-sprachfoerderung-fehlen/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Für Kinder im Vorschulalter mit Sprachförderbedarf wäre in manchen BL schon eine Maßnahme verpflichtend.
siehe z.B. hier:
https://uebersicht-sprachfoerderung.stiftung-fairchance.org/programm/vorkurs-deutsch-240
Wie haben wir zu DDR-Zeiten gesagt: keine Leute, keine Leute.
Aber ich habe gelesen, dass demnächst eine Fachkräfte-Schwemme über die BRD hereinbrechen wird. Zig-tausende werden nach Planungen der Konzerne und mittelständischen Betriebe entlassen.
Vielleicht finden sich ein paar Fachkräfte, die die Sprachevermittlung übernehmen können. Lehrer kann schließlich jeder.
Spaß 😉
Schwimmbad mit Rutsche heißt Spaßbad, Schule im Rutschen heißt – äh, jetzt muss mir jemand helfen, ich komm nicht drauf.
Vielleicht gibt das folgende Video Aufschluss über das eigentliche Problem (Das Interview nach der Doku !): Ein Kultusminister, der einige Jahre (niedrig einstellige Zahl) vor Kindern von reinen Oberstufenkursen ohne fachfremden Unterricht gestanden hat, erklärt jetzt mal, warum wirklich alle lügen (u.a. scheinbar auch die Autoren der Studie hier) und er der einzige ist, der wirklich – ohne jemals in Schule Verantwortung getragen zu haben – Ahnung von allem hat (auch wenn er es selbst nie leisten musste). Ich denke, das Schiff wird untergehen bei so viel prof. Reflexionsfähigkeit und Realitätswahrnehmung