BERLIN. Die aktuelle OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2025“ stellt Deutschland ein widersprüchliches Zeugnis aus. Auf der einen Seite: internationaler Spitzenwert bei den MINT-Abschlüssen. Auf der anderen Seite: eine wachsende soziale und bildungsbiografische Kluft. Immer mehr junge Menschen bleiben schlicht außen vor. Verschenktes Potenzial. Eine Analyse von News4teachers-Herausgeber Andrej Priboschek.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) feierte die neuen OECD-Zahlen als Ausweis von Stärke: „Deutschland ist MINT-Weltmeister.“ Tatsächlich: Deutschland glänzt – auf den ersten Blick jedenfalls. 35 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen eines Bachelor- oder gleichwertigen Programms schließen hierzulande in einem der MINT-Fächer ab. Das ist der höchste Anteil im OECD-Vergleich; der Schnitt liegt bei 23 Prozent.
In Zeiten von Digitalisierung, Energiewende und Industrie-Transformation ist das eine Kenngröße von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Auch international wirkt das System: Der Anteil ausländischer Studierender ist seit 2013 von 7,1 auf 12,7 Prozent (2023) gestiegen, deutlich über dem OECD-Schnitt von 7,4 Prozent. Aktuellere Daten des Statistischen Bundesamtes belegen die Fortsetzung des Trends: Im vergangenen Wintersemester waren 492.600 internationale Studierende eingeschrieben – rund 17 Prozent von insgesamt 2,87 Millionen.
„Der international herausragende Anteil von Absolventinnen und Absolventen in MINT-Fächern zeigt, welches Potenzial wir haben“
Deutschland liegt damit unter den nicht englischsprachigen Ländern weltweit vorn, insgesamt auf Platz vier hinter den USA, Großbritannien und Australien. Studierende aus Asien bilden die größte Gruppe (44 Prozent), 31 Prozent kommen aus anderen europäischen Ländern. Dass in Deutschland in der Regel keine Studiengebühren gezahlt werden müssen, trägt zweifellos zur Attraktivitätssteigerung bei.
 Auf den zweiten Blick zeigen die OECD-Daten aber eine Entwicklung, die politisch schmerzen muss: Die Kluft bei den Bildungsabschlüssen wächst. Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen ohne Abitur oder Berufsabschluss stieg seit 2019 von 13 auf 15 Prozent. Gleichzeitig legte in Deutschland der Anteil der jungen Erwachsenen mit Hochschulabschluss von 33 auf 40 Prozent zu (OECD-Schnitt: 48 Prozent). Das bedeutet: Mehr Exzellenz oben – mehr Abgehängte unten. Auch beim Grundproblem sozialer Selektivität bewegt sich zu wenig: Herkunft und Familie beeinflussen in Deutschland weiterhin stark den Bildungserfolg; wie OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher in Stuttgarter Medien kritisierte, schneidet Deutschland bei der Chancengerechtigkeit schlechter ab als die USA.
Auf den zweiten Blick zeigen die OECD-Daten aber eine Entwicklung, die politisch schmerzen muss: Die Kluft bei den Bildungsabschlüssen wächst. Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen ohne Abitur oder Berufsabschluss stieg seit 2019 von 13 auf 15 Prozent. Gleichzeitig legte in Deutschland der Anteil der jungen Erwachsenen mit Hochschulabschluss von 33 auf 40 Prozent zu (OECD-Schnitt: 48 Prozent). Das bedeutet: Mehr Exzellenz oben – mehr Abgehängte unten. Auch beim Grundproblem sozialer Selektivität bewegt sich zu wenig: Herkunft und Familie beeinflussen in Deutschland weiterhin stark den Bildungserfolg; wie OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher in Stuttgarter Medien kritisierte, schneidet Deutschland bei der Chancengerechtigkeit schlechter ab als die USA.
Genau an dieser Bruchstelle setzen die Reaktionen der großen Lehrerverbände an. Der Deutsche Philologenverband (DPhV) begrüßte den MINT-Erfolg, warnte aber – angesichts großer Herausforderungen – vor Qualitätseinbrüchen im System. Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing sagte: „Die vorgeschlagenen politischen Maßnahmen wie etwa den Lehrkräftemangel vornehmlich durch Quereinstiege, eine verstärkte Nutzung außerschulischer Lernorte und digitale Bildungsangebote auszugleichen, greifen zu kurz. Sie verlagern das Problem – weg vom schulischen Lernort und qualifizierten Fachpersonal – hin zu externen und digitalen Lösungen.“

Der Verband fordert „die Beibehaltung und Sicherung des 24-monatigen Referendariats, das zunehmend verkürzt wird“. Diese Ausbildungsphase sei essenziell – fachlich wie pädagogisch. Lin-Klitzing wurde grundsätzlich: „Der international herausragende Anteil von Absolventinnen und Absolventen in MINT-Fächern zeigt, welches Potenzial wir haben – wenn wir jetzt konsequent in unsere Lehrkräfte investieren. Quereinstiege und digitale Bildungsangebote sind kein Ersatz für eine fachlich fundierte Ausbildung in Studienseminar und Schule als zentralen Bildungs- und Ausbildungsräumen.“
Konkret verlangt der DPhV Entlastung im Schulalltag durch Bürokratieabbau, Möglichkeiten zur Altersteilzeit, präventiv-medizinische Angebote, eine Absenkung des Stundendeputats, kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen – und eben das 24-monatige Referendariat mit professioneller Ausbildung.
Warum diese Forderungen für die MINT-Zahlen nicht randständig sind, sondern zentral: Die Zahl und Qualität der MINT-Abschlüsse beginnt nicht erst an der Hochschule. Sie entsteht über Jahre hinweg im Unterricht der Primar- und Sekundarstufe – in Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik – und steht und fällt mit der Qualifikation der Lehrkräfte. Eine solide Lehrkräftebildung stärkt das fachdidaktische Wissen, die Klassenführung, die Diagnostik und die individuelle Förderung. Genau diese Kompetenzen entscheiden darüber, ob Schülerinnen und Schüler in der kritischen Phase der Sekundarstufe I den Anschluss halten, ob sie Leistungskurse in der Sekundarstufe II wählen, ob sie sich MINT überhaupt zutrauen und dann erfolgreich durchs Studium kommen.
„Während die Bundesregierung heute MINT-Erfolge feiert, zeigen die Daten eine erhebliche Bildungsungerechtigkeit“
Verkürzte Ausbildungswege, dauerhafte Quereinstiege ohne systematische pädagogische Qualifizierung oder Überlastung durch hohe Deputate und Bürokratie erhöhen das Risiko von Unterrichtsausfall, fachlichen Lücken, sinkender Lernwirksamkeit – und am Ende von Studienabbrüchen. Wer also den MINT-Erfolg sichern will, muss die Pipeline stabilisieren: durch professionelle, ausreichend lange Ausbildung und gesunde, fortgebildete Lehrkräfte, die bleiben.
Die GEW richtet mit Blick auf die OECD den Scheinwerfer auf die Kompetenzkluft – und deren soziale Brisanz. Vorsitzende Maike Finnern sagte: „Ein Jahr nach dem Weckruf der GEW zum Bildungsbericht 2024 bestätigt die heute veröffentlichte OECD-Studie ‚Bildung auf einen Blick 2025‘ erneut: Deutschland versagt weiterhin bei der Chancengleichheit.“ Ihr Kernbefund: 145 Kompetenzpunkte trennen in Deutschland junge Erwachsene mit Hochschulbildung von jenen ohne Sekundarabschluss II. In der Gesamtbevölkerung beträgt die Kluft immer noch 75 Punkte. Deutschland gehört damit zusammen mit der Schweiz und den USA zu den Ländern mit den größten Kompetenzunterschieden nach Bildungsstand; Länder wie Spanien, Polen und Kroatien weisen deutlich geringere Abstände auf.
Finnerns politisches Fazit: „Während die Bundesregierung heute MINT-Erfolge feiert, zeigen die Daten eine erhebliche Bildungsungerechtigkeit. Diese extremen Unterschiede belegen, dass das Startchancen-Programm viel zu klein dimensioniert ist.“ Hintergrund: Zehn Milliarden Euro geben Bund und Länder in den nächsten zehn Jahren dafür aus, Schulen an besonders herausfordernden Standorten zu unterstützen. Die GEW fordert hingegen strukturelle Reformen (nämlich grundsätzlich davon weg zu kommen, Resourcen gleichmäßig mit der Gießkanne im Bildungssystem zu verteilen) und eine dauerhafte, deutlich höhere Finanzierung – orientiert an der Selbstverpflichtung von 2015 mit 10 Prozent des BIP für Bildung. Ihr Leitmotiv aus dem vergangenen Jahr bekräftigt Finnern ausdrücklich: „Nur wenn wir Ungleiches auch ungleich behandeln, können wir einen nennenswerten Beitrag dazu leisten, der sozialen Spaltung entgegenzuarbeiten.“
Damit ist der Blick auf die Finanzierungsseite unvermeidlich. Ja, Deutschland gibt pro Bildungsteilnehmer mehr aus als der OECD-Durchschnitt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt aber bleibt das Land mit 4,4 Prozent unter dem Niveau von Staaten wie Norwegen oder Großbritannien, die über 6 Prozent investieren. Diese Relativgröße zählt – denn sie zeigt, welchen Anteil der gesamtwirtschaftlichen Leistung eine Gesellschaft tatsächlich in Bildung umschichtet. Die OECD erinnert regelmäßig daran, dass „Bildung auf einen Blick“ weit mehr ist als ein Hochschulreport: Der Report betrachtet das System von frühkindlicher Bildung über Schule und Ausbildung bis zur Hochschule, berichtet über Personalschlüssel, Klassengrößen, Kosten und Erträge von Bildung. In der Summe ist das Bild für Deutschland klar zweigeteilt: starke MINT-Outputs an der Spitze, wachsende Ausfallrisiken am unteren Ende. News4teachers / mit Material der dpa
Hier lässt sich der vollständige Bericht “Bildung auf einen Blick” herunterladen.
Hier geht es zu allen Beiträgen des News4teachers-Themenmonats “Mission MINT”.
Der Beitrag ist ursprünglich am 10. September 2025 erschienen – und wurde für den News4teachers-Themenmonat “Mission MINT” aktualisiert.






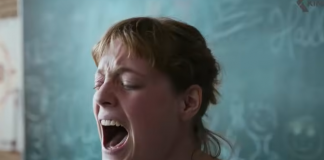
Das mit den 4,4% vom BIP in DE zu 6% in NOR ist m.M. schwer vergleichbar, denn es hängt ja in DE von den jeweiligen Bundesländern ab, wie viel investiert wird. Das reicht m.W. z.B. von 8.900€ pro Schülerin und Jahr in Bundesland A bis zu 13.400€ in Bundesland B. Beim Bildungsmonitor Schulqualität liegen die beiden Länder allerdings mit Platz 13 und 15 dicht beieinander. Beim Ranking der Bundesländer nach relativen Bildungsausgaben ergibt sich dann auch ein differenziertes Bild. Dass Geld allein nicht unbedingt ausschlaggebend für Bildungserfolge sein muss, zeigt m.M. dass NOR bei PISA-2022 in den drei getesteten Bereichen Mathematik/Lesen/Naturwissenschaft schlechtere Werte aufwies als der Schnitt von Gesamt-DE und in NOR mit 19% deutlich mehr Schüler*innen angaben sich an der Schule nicht wohl oder fehl am Platz zu fühlen als die 14% in DE.
Trotzdem könnten m.M. bessere und gezieltere Bildungsinvestitionen auch in DE natürlich nicht schaden.
Ich sehe es teilweise ähnlich wie im Artikel beschrieben, die Schere öffnet sich immer weiter zwischen jungen Menschen mit qualifizierten Hochschulabschlüssen und Jugendlichen ohne Ausbildung und mit sehr begrenzter Perspektive.
Ohne zusätzliche Ressourcen versuchen wir, immer mehr Schüler durch das Abitur zu bringen, reduzieren die Anforderungen – und entwerten damit das Abitur. Je mehr Abiturienten es gibt, desto mehr werden Haupt- und Realschulen zu “Resteschulen” degradiert und deren Absolventen abgewertet: Viele Ausbildungen, in die man vor 20-30 Jahren vielleicht einen Real- oder Hauptschüler aufgenommen hätte, erwarten heute zumindest einen erweiterten Sek I-Abschluss. Damit wird die Perspektive eben immer schlechter.
Die leistungsstarken Schüler scheinen es ja trotzdem zu schaffen, später erfolgreich ein MINT-Studium aufzunehmen.
Natürlich ist es schön, wenn deutsche Hochschulen eine guten internationalen Ruf haben. Aber 17% internationale Studenten in den MINT-Fächern bedeutetauch, dass gut eine halbe Million internationaler Studenten hier weitgehend kostenlos studiert, während jeder Studienplatz 40.00-50.000 Euro kostet. Die meisten internationalen Studenten, die ich kennengelernt habe, haben Deutschland dann nach dem Studium wieder verlassen.
Quer- und Seiteneinstiege laufen in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich ab. Bei MINT-Fächern sind bei uns noch immer ein Master-Abschluss mit Studienprofil, aus dem sich 2 Fächer ableiten lassen und 3 Jahre Berufserfahrung die Voraussetzung, es folgt dann ein 1,5-jähriger Vorbereitungsdienst mit den normalen Referendaren.
Unsere zumeist promovierten Naturwissenschaftlern machen bei uns gut die Hälfte der naturwissenschaftlichen Lehrkräfte aus. Ohne diese könnten wir unseren Fachbereich eigentlich dicht machen. Insofern sehe ich das etwas anders als Frau Lin-Klitzing…
Falls sich jemand auch für weitere Daten interessiert, im Report werden auch Charts zu den “Neets” dargestellt, also jungen Menschen im Alter von 18 -24 Jahren die weder in Ausbildung noch im Arbeitsmarkt wären. Hier wäre der prozentuale Anteil in DE signifikant niedriger als der Schnitt in OECD und EU, ebenso die prozentuale Zunahme oder die Dauer der Erwerbslosigkeit. Das könnte evtl. im Zusammenhang mit OECD-Berichten stehen, dass die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt in DE überdurchschnittlich gut funktioniert.
Wo ist Deutschland denn aktuell MINT-Weltmeister? Bitte die Innovationen aufzählen, die in den vergangenen 20 oder 30 Jahren in Deutschland erfunden wurden.
Da würde mir spontan z.B. das MP3-Format für Mediendateien einfallen.
Motormanagement inkl. Prüfstanderkennung
Ob Hersteller wie Fiat und Jeep die in Deutschland ausspioniert haben?
Wieso in Industriespionage investieren, wenn man doch beim Bosch einkaufen kann.
MP3 entfällt leider, weil eher ein Kind der 1980er Jahre.
Dann probieren Sie es mit MRnA-Impfstoffen.
Dafür haben meines Wissens eine Ungarin und ein Amerikaner den Nobelpreis für Medizin erhalten.
Soweit ich weiß wurde der erste Prototyp eines MP3-Players im Jahr 1994 vom Fraunhofer Institut gebaut.
Und wer hat den cash gemacht, es wirklich in der gelebten Realität eingeführt?
…eben.
Ähnlich wie damals bei der Glühbirne ?
Nee, wie beim Fernsprechapperat.
Und wo wird/wurde daraus Realität gemacht ?
USA.
Die haben vermutlich Spearmint-Weltmeister gemeint.
Wer hätte gedacht, dass jahrelange Warnungen vor Chancenungleichheit und Folgen sich einer öffnenden Schere zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft sich gesellschaftlich bemerkbar machen würden. Ich dachte, wir hätten noch locker zehn weitere Jahre folgenlos igrnorieren können (augenroll)
https://www.wiwo.de/erfolg/trends/liste-deutscher-erfindungen-20-beruehmte-erfindungen-aus-deutschland/26701472.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/nobelpreistraeger/nobelpreis-deutsche-nobelpreistraeger-100.html
http://www.cos-mig.de/genies.html
War zu Zeiten dieser Erfindungen/Entdeckungen die Schere zwischen arm und reich kleiner?
Ja
P.S.: in China gibt es auch eine wachsende “Schere” zwischen arm und reich, dazu kommt ebenfalls ein großes demographisches Problem (Überalterung wegen der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik). Trotzdem sind die führend in neuen Technologien, …https://http://www.sueddeutsche.de/politik/podcast-nachrichten-chinas-arbeiter-und-die-wachsende-schere-zwischen-arm-und-reich-1.5763857
https://www.spektrum.de/news/china-vergreist-so-schnell-wie-es-noch-kein-land-erlebt-hat/2104947
Es muss also noch andere Ursachen für die deutschen “Probleme” geben.
China löst diese “Probleme” eher nicht durch Migration. Andererseits wandern viele junge chinesische Akademiker aus, hörte ich.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen.
Was soll hier Ihre Aussage sein?
Deutschland hat ein demografisches Problem, aber China ebenfalls?
Russland und andere Länder der “traditionellen” Familie auch.
Man KÖNNTE annehmen, dass der demografische Wandel eine echte Herausforderung darstellt, aber seien Sie unbesorgt! Viele Teilnehmer*innen im Forum werden ALLES der Realität entgegenwerfen, um ein unvermeidbares Problem auf Gesellschaftsebene ignorieren zu können – wie beim Klima 😉
Das Deutsche Problem ist, meiner Meinung, dass die Kosten für Entwicklung und Vertrieb (sowie für Lehre, Ausbildung und Unterricht) im Weltvergleich einfach zuteuer ist.
Die Marktwirtschaft wird es richten:
Wenn man “Export-Weltmeister” sein möchte, muss man eben zu den günstigsten Konditionen an Externe verkaufen.
Um das BIP zusteigern, müsste man eine Lohnkostenspirale Richtung “nach unten” antreten. Gewerkschaften müssten dafür eintreten, dass nicht die Löhne, Gehälter und sonstige Prämien steigen, sondern dass das Management die “Verkaufspreise” reduziert. Niedrige Preise führen zu erhötem Verkauf, es sei denn die Abnehmer können mit dem Verkaufsgut nichts anfangen.
Das BIP als Maß für die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Landes in einem bestimmten Zeitraum, indem es den Wert aller produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen erfasst.
Bruchrechnen und Logik ist offenschtlich sehr schwer in der wirtschaftlichen Tat zu beachten…
[ Summe (Einnahme) – Summe (Ausgaben) ] / Zeit
Der Wert des Buches steigt, wenn
Aber warum sollte es erstrebenswert sein, das BIP überhaupt steigen zu lassen?
(Bruch)rechnen und Logik? Geht’s noch? Worl-Life-Balance sind viel wichtiger für die AN und für die AG der max. Profit. 🙂
Was halten Sie denn für die Ursache, dass der Anteil junger Menschen von 18 – 24 Jahren, die weder in Ausbildung oder im Arbeitsmarkt stehen im Schnitt der EU und der OECD so deutlich höher wäre als in DE, ebenso die prozentuale Zunahme der betroffenen Menschen?
Von welchem Anteil reden wir?
Wie viel höher ist dieser im EU- bzw. OECD-Schnitt?
Wenn der bei anderen höher seien sollte, wird das – ich mutmaße – nicht daran liegen, dass die alle gerne Minijobs machen, sondern (wie im Artikel beschrieben) ggf. bessere Bildungsgerechtigkeit genießen. Vielleicht werden die auch nicht mit einem feigen Ruf nach “Eigenverantwortung” abgespeist, sich selber beizubringen, was die Schule nicht leisten will (Shout Out an Katze and friends! 😀 )?
Aber mir fehlen hier noch Ihre Zahlen. Auf welche Quelle beziehen Sie sich?
Glauben Sie tatsächlich, dass es für mehr Bildungserechtigkeit in anderen Ländern spricht, wenn dort prozentual mehr junge Menschen weder in Ausbildung noch noch Arbeit sind?
Und was soll die Frage nach der Quelle schon wieder? Die ist doch oben eindeutig angegeben.
“Glauben Sie tatsächlich, dass es für mehr Bildungserechtigkeit in anderen Ländern spricht, wenn dort prozentual mehr junge Menschen weder in Ausbildung noch noch Arbeit sind?”
Nein, für bspw. eine schlechtere Wirtschaftslage. Sonst würden Wir ja über Abschlüsse schreiben und nicht über Arbeit und Ausbildung
Umso erstaunlicher, warum Sie oben dann schreiben, “ggf. bessere Bildungsgerechtigkeit genießen.”
“eine schlechtere Wirtschaftslage”
das würde allerdings nicht zu folgenden Meldungen passen:
“OECD: Deutschland wächst 2024 so langsam wie kaum ein anderer Industriestaat”
“OECD: Deutschland 2025 mit schwächstem Wachstum aller Industriestaaten”
Ein Wachstum ist ein Wachstum .)
Hey, wir KÖNNEN also, das ist eine gute Nachricht.
Jetzt müssen wir als Gesellschaft “nur” noch wollen, anstelle zu hoffen, dass sich das Problem von alleine lö… ich meine, dass die Eltern plötzlich – vielleicht Magie? – alles anders machen.
Bis dahin träumen manche im Forum einfach weiter, dass Familien, welche bei den Hausaufgaben nicht helfen (können), Strafgebühren bezahlen oder verhungern müssen (augenroll)